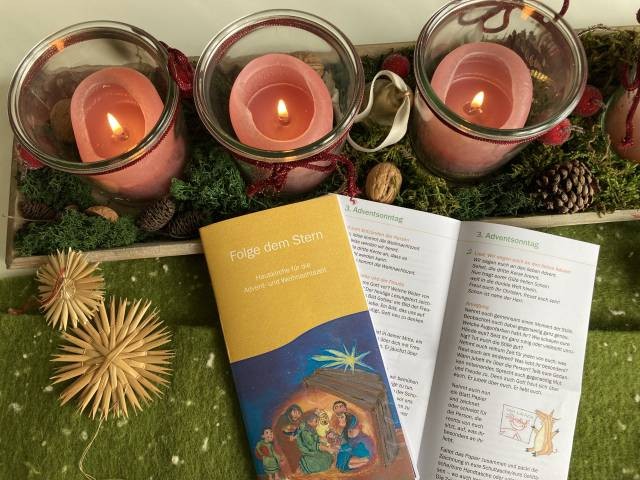Weihnachtsgruß
Gruß und Segen zum Weihnachtsfest 2024 von Bischof Hermann Glettler
Weitere ausführlichere weihnachtliche Podcasts mit Bischof Hermann finden Sie in der Serie "Wer nichts glaubt, muss alles wissen" von Geistreich Tirol: Folge 43, beispielsweise auf Youtube, Spotyfy oder Podcasts.de
oder auf dem Podcast von Passivhaus Österreich
sowie auf www.meinbezirk.at
Hier wäre ein Youtube video
Inhalte von externen Medien werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf externe Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Bekenntnis, dass jeder Mensch göttliche Würde und Wert hat
Weihnachten ist für Katholiken, nach Ostern, das zweitwichtigste Fest im Jahr. Rund 2,5 Milliarden Christ:innen weltweit feiern das Fest der Geburt Christi und damit nach ihrem Verständnis die Menschwerdung Gottes. Sie feiern, dass Gott in seinem Sohn Jesus Mensch geworden ist, dass er durch ihn ganz und gar im Menschen gegenwärtig geworden ist. Indem Gott selbst Mensch geworden ist, bekennen die Christ:innen, dass jeder Mensch göttliche Würde und Wert hat. Im Leben Jesu lüftet sich Gottes Geheimnis, mit Jesu Händen berührt Gott die Welt, im Kind aus Bethlehem und dem Mann aus Nazareth wird Gottes Wille konkret fassbar. Das Wort Weihnachten selbst kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet: „Ze wihen nahten" – „in der Heiligen Nacht".
Geschichte des Weihnachtsfestes
Die ersten Christ:innen feierten zwei Feste im Jahr, um das Ineinander von Gott-Sein und Mensch-Sein Jesu auszudrücken: Die Göttlichkeit Jesu wurde besonders zu Ostern im Fest der Auferstehung hervorgehoben. Am Fest Erscheinung des Herrn am 6. Jänner gedachten die frühen Christ:innen der Menschwerdung, der Erscheinung Gottes im Menschen Jesus von Nazareth. Erst im 2. Jahrhundert wurde explizit die Geburt Jesu Christi gefeiert. Die christliche Liturgie feiert seit dem 4. Jahrhundert die Geburt Jesu Christi als Ankunft des Erlösers in der Geschichte der Menschheit. Der 25. Dezember wurde von den Christ:innen in Rom festgelegt, da dort das Fest des unbesiegten Sonnengottes unmittelbar nach der Wintersonnenwende gefeiert wurde und die Christ:innen dieses Fest aus Protest einfach umdeuteten. Nach Ende der Christenverfolgung wurde das Datum für das Fest beibehalten. Nach und nach wurde das Fest auch in der Kirche verankert. Zwischen dem 9. und 16. Jahrhundert entstanden viele Feierformen, die heute selbstverständlich dazugehören: Krippenverehrung, Weihnachtslieder, Weihnachtsschmuck. In der Zeit vom 16. bis zum 19. Jahrhundert wurde das Weihnachtsfest zum Familienfest. Der Christbaum und das Beschenken zogen in die Privathäuser ein. Lange Zeit wurden die Geschenke an die Kinder am Nikolaustag verteilt und am Weihnachtsabend eine Andacht vor der Krippe gehalten.
Weihnachtslieder und Christbaum
Erste Belege für Weihnachtslieder stammen aus dem frühen Mittelalter. Die „Leisen“ (von griechisch „Kyrie eleison“ – Herr, erbarme dich) waren Wechselgesänge in den Kirchen zwischen Geistlichen und Gläubigen. Die gefühlvolle Bewunderung für den neugeborenen Messias drückt sich in dem mittelalterlichen Lied: „In dulci jubilo“ aus. Viele Weihnachtslieder sind in Form von Wiegenliedern geschrieben, wie zum Beispiel das Wiegenlied „Es wird scho glei dumpa“, das nachweislich aus Oberösterreich stammt.
Der Christbaum kommt aus dem deutschen Sprachraum nach dem 16. Jahrhundert nach Österreich. Die grünen Zweige bedeuten Leben und sind Zeichen des kommenden Frühlings und Wachsens. In Österreich bezeugte ungewöhnlicherweise ein österreichischer Geheimpolizist in einem Bericht um 1814 (Wiener Kongress) aktenkundig den ersten Wiener Christbaum. Er befand sich unter den Gästen des jüdischen Bankiers Arnstein und schrieb: „Bei Arnsteins war vorgestern nach Berliner Sitte ein sehr zahlreiches Weihbaum- oder Christbaumfest. Es waren dort ... alle getauften und beschnittenen Anverwandten des Hauses. Alle gebetenen, eingeladenen Personen ... erhielten Geschenke oder Souvenirs vom Christbaum. Es wurden nach Berliner Sitte komische Lieder gesungen.“