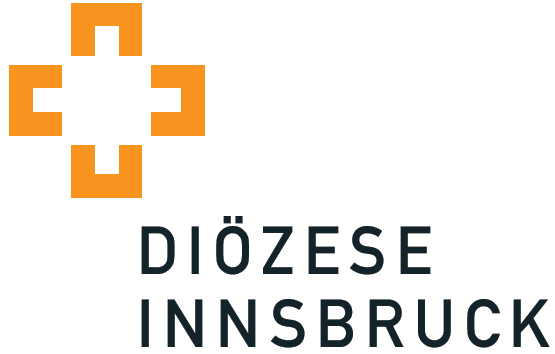Ostersonntag: Höchster katholische Feiertag
Als Tag der Auferstehung Jesu Christi ist der Ostersonntag der ranghöchste Feiertag in der katholischen Kirche. In vielen Kirchen werden zu den Ostergottesdiensten die mitgebrachten Speisen gesegnet. Dahinter steht der Gedanke, dass nach der Entbehrung der Fastenzeit der erste Genuss gesegnet wird und dass durch die Segnung der Speisen der Zusammenhang des Familienessens mit dem Gottesdienst spürbar wird. Gleichzeitig ist der Osterkorb symbolhaft für das Leben und die Früchte der Erde. Mit diesem Tag beginnt die 50-tägige Osterzeit bis Pfingsten sowie die sogenannte Osteroktav bis zum Weißen Sonntag.
Ostern geht auf die früheste Zeit der Kirche zurück. Seit dem Konzil von Nizäa (325 n. Chr.) wird Ostern immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. Die orthodoxe Kirche folgte der Kalenderreform unter Papst Gregor XIII. im Jahr 1582 nicht, deshalb feiern Ost und West in den meisten Fällen zu verschiedenen Terminen.
Auch wenn die Auferstehung selbst in der Bibel nicht beschrieben wird, gibt es darin Berichte von den Erscheinungen des auferstandenen Jesus sowie über das Auffinden des leeren Grabes und die Kunde eines Engels von der Auferstehung. Für Christen bezeichnet der deutsche Erwachsenen-Katechismus die Auferstehung als Gewähr, "dass am Ende das Leben über den Tod, die Wahrheit über die Lüge, die Gerechtigkeit über das Unrecht, die Liebe über den Hass und selbst den Tod siegen wird."
„Urbi et orbi“ – ein weltweiter Segen
Zu Weihnachten und Ostern wird vom Papst der Segen "Urbi et orbi" erteilt. Übersetzt bedeuten die lateinischen Worte: "der Stadt und dem Erdkreis". Dies drückt den Anspruch der katholischen Kirche, weltumfassend zu sein. In der römischen antike galt Rom als Mittelpunkt des Erdkreises. Mit dem Segen ist ein vollkommener Ablass verbunden. Dieser bezieht sich auf alle zeitlichen Sündenstrafen. Er setzt voraus, dass die jeweilige Schuld durch Beichte, Kommunionempfang und Gebete sowie Werke der Buße schon getilgt ist. Dies gilt auch für alle Gläubigen, die der Zeremonie im Radio, Fernsehen oder Onlinestream beiwohnen.