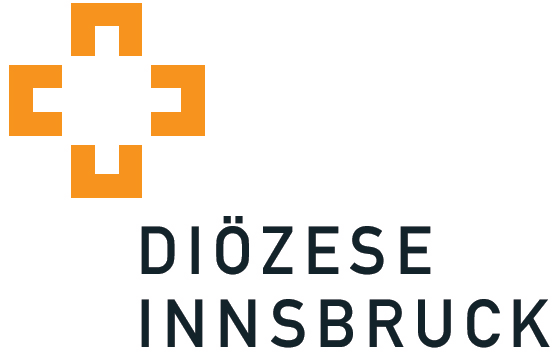Friede in Europa - ein christliches Projekt?!
Am Gedenktag des Diözesanpatrons Petrus Canisius, dem 27. April, luden Diözese Innsbruck und die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität zum "Dies Facultatis & Diözesantag". In diesem Jahr fand die Veranstaltung unter dem Motto "Friede in Europa - ein christliches Projekt?!" im Kaiser-Leopold-Saal der Universität Innsbruck statt.
In Referaten und Diskussionen war man bemüht, ans Licht holen, was Christen in der politischen Entwicklung seit 1918 beigetragen haben - vom Widerstand gegen demokratische Entwicklungen bis hin zur Unterstützung einer Versöhnung und Überwindung alter Feindbilder und Hassformen. Die Leitfrage lautete dabei: "Was können wir tun, um das 'Friedensprojekt Europa' neu zu beleben"?
Huber: Dank für höchst relevante Fragestellung
Generalvikar Propst Florian Huber, in Vertretung von Bischof Hermann Glettler, in seiner Begrüßung: „Ein Dankeschön gilt für das Miteinander von Theologischer Fakultät der Universität Innsbruck und der Diözese Innsbruck in einer für die Gesellschaft und die Kirche höchst relevanten Fragestellung an dem Tag, der dem Gedenken an den Diözesanpatron Petrus Canisius gewidmet ist.“ Besonderer dankte Huber namens der Diözese Innsbruck den Vorbereitenden dieser Veranstaltung aus der Theologischen Fakultät und von der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Edith Stein.
Quitterer: Rolle von Christinnen und Christen im Friedensprojekt Europa leider sehr ambivalent
In seiner Begrüßung wies Dekan Josef Quitterer darauf hin, das Christinnen und Christen sich schon von ihrem Selbstverständnis her für Demokratisierung, Dialog und Verständigung zwischen Völkern, Kulturen und Religionen einsetzen müssten. Die Rolle von Christinnen und Christen im Friedensprojekt Europa sei jedoch leider sehr ambivalent. „Es gibt großartige Beispiele für christlich motivierte Friedens- und Versöhnungsprojekte (z.B. St. Egidio). Es gibt aber auch Gegenbeispiele – rechtsextreme und nationalistische Instrumentalisierungen des Christentums“, so Quitterer. Gerade heute sei es wichtig, gegen selbsternannte Verteidiger des sogenannten 'christlichen Abendlandes' aufzutreten. Nationalistische und undemokratische Gesellschaftsformen seien schon deshalb nicht mit dem Christentum kompatibel, da sie dem dort prokamierten Menschen- und Gottesbild diametral zuwiderliefen.
Als Hauptreferenten eingeladen waren Ursula Kalb von der Gemeinschaft Sant'Egidio, der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Erwin Teufel, Severin Renoldner von der Pädagogischen Hochschule Linz und der Politologe Anton Pelinka.
Sant’Egidio: Leben aus dem Evangelium im Gebet, der Arbeit mit Armen, Frieden durch Vermittlung und Dialog der Religionen
Im Eröffnungsreferat ging Ursula Kalb, München, auf die „Wege des Friedens“ - Der Einsatz der Gemeinschaft Sant’Egidio“ ein.
„Ein Weg des Friedens ist die Erinnerungskultur, die immer Teil unseres Bildungssystems bleiben muss oder auch verstärkt werden muss“, so Kalb in ihrer Einleitung, in welcher sie auf gesellschaftspolitische Entwicklungen des bewussten Verdrängens von Teilen der Geschichte hinwies.
Die Geschichte der Gemeinschaft Sant’Egidio begann 1968, als einer der zahlreichen Zusammenschlüsse innerhalb des bewegten Milieus von Jugendlichen dieser Zeit, in der damals schon Fragen des Dialogs der Kulturen und des Friedens aktuell waren. Der damals 18jährige Andrea Riccarda aus Rom stellte sich die Frage: „Wie kann man die Strukturen verändern, die Welt, ohne das Herz der Menschen zu verändern? Das Evangelium und das Wort Gottes allein könne zum Herzen der Menschen sprechen, so Riccardo. Er sammelte Jugendliche um sich und bildete eine Gemeinschaft, die sich wiederum um das Evangelium versammelte. Die Gemeinschaft begann, die Welt der Armen kennen zu lernen, mit ihnen zu arbeiten, aber vor allen Dingen der Traum, mit ihnen gemeinsam das Evangelium zu leben.
Mittlerweile ist Sant’Egidio eine weltweite Bewegung in etwa 70 Ländern, und gerade der Einsatz für Gerechtigkeit und Friede ist stärker geworden. Immer öfter wird die Gemeinschaft ersucht, Friedensvermittler zu sein und sich für entrechtete Völker einzusetzen. „Dabei ist das gemeinsame Gebet für uns grundlegend. In jeder Stadt, in jeder noch so kleinen Gemeinschaft weltweit, treffen sich die Mitglieder zu einem gemeinsamen Abendgebet, indem immer die Schrift gelesen und ausgelegt wird“, so Kalb.
Sant’Egidio ist keine internationale Organisation, sie ist in ihrer Arbeit auch nicht von einer Regierung abhängig. Gründer Andrea Riccardi spricht von einer Leidenschaft für die große Welt. Diese Leidenschaft entspringt einer Spiritualität des Evangeliums, die den Krieg als ein Übel ansieht. Krieg sei der Vater aller Armut.
Die Gemeinschaft Sant’Egidio hat auch verschiedene Dialoginitiativen zwischen den Religionen und zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen organisiert. Vor allem hat sie nach dem großen Friedensgebet von Assisi 1986, zu dem Johannes Paul II. eingeladen hatte, jährlich in verschiedenen Ländern der Welt Treffen von Oberhäuptern der verschiedenen Religionen veranstaltet in dem Bewusstsein, dass die Religionen wichtige Beiträge für den Frieden leisten können, aber auch zur Heiligung des Krieges eingesetzt werden können.
Die Humanitären Korridore – Legale Einreise von Geflüchteten nach Europa
Kalb über aktuelle Aktivitäten: „Wir haben uns nicht mit einer Welt abgefunden, die immer gleich und ungerecht bleibt, die sich an Konflikte, Kriege und an den Tod gewöhnt, die sich angesichts der dramatischen Armen verschließt. Deshalb haben wir das Projekt der humanitären Korridore vor zwei Jahren gestartet, in Italien, Frankreich und Belgien. Auf legalem Weg kommen Flüchtlinge aus Syrien und anderen Ländern, die in Flüchtlingslagern im Libanon oder in Äthiopien gestrandet sind, nach Italien und werden von der Gemeinschaft, den evangelischen Kirchen und der Caritas aufgenommen, damit die Integration vom ersten Moment an funktioniert.“
Kalb abschließend: „Die Gemeinschaft Sant’Egidio feiert in diesem Jahr ihr 50. Jahr. Papst Franziskus sagte uns bei seinem Besuch: Denkt daran, das Evangelium ist für alle, alle alle, tutti, tutti tutti. Ihr müsst da sein für alle, alle alle. Schließt niemanden aus. Wir haben das kleine Buch des Evangeliums in den Händen. In diesem kleinen Buch offenbart sich das große Geschenk einer Friedenskraft. Mit dieser Kraft werden wir in der Lage sein, zu trösten, zu heilen, die Herzen zur Liebe zu bekehren und die Welt zu verändern. Mit Begeisterung machen wir uns deshalb weiter auf den Weg, ja mit noch größerer Begeisterung als am Anfang, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das Evangelium wirklich eine Welt in Frieden schaffen kann.“
Teufel: Es ist wichtig, sich auf die Substanz dessen, was in Europa erreicht worden ist zu besinnen
Erwin Teufel, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, betonte in seinem Vortrag, dass Friede keinen Naturzustand darstellt, sondern dass es vielmehr der „Friedensstifter“ bedarf – in jeder Generation und in jedem Land. Dies verdeutlichte er durch die Erwähnung des Werkes von Professor Sheehan mit dem Titel „Kontinent der Gewalt: Europas langer Weg zum Frieden“. Durch die darauffolgende Schilderung der 48 Kriege in Europa seit der großen – westfälischen – Friedenszeit zeigt er auf, dass dieser Titel durchaus zutrifft. Er bezieht sich darauf, wie euphorisch und siegessicher junge Söhne zu Beginn des ersten Weltkrieges noch in den Krieg zogen und wie bald sich die Opferzahlen enorm steigerten – mit dem Tiefpunkt von 50 bis 65 Millionen Toten mit Ende des 2. Weltkrieges.
Erwin Teufel griff in seinem Vortrag zwei wesentliche Aspekte aus der ersten Friedens- und Europarede nach Kriegsende des britischen Premierministers Winston Churchill heraus. Churchill forderte einerseits „die Vereinigten Staaten von Europa“ und andererseits betont er, dass Deutschland und Frankreich damit beginnen müssen. Teufel zeigte auf, dass dies auch tatsächlich passiert ist, zunächst in Form der 'Montanunion' – einer Gemeinschaft von Kohle und Stahl – der sich bis zur „großen Zeitenwende“ 1989 15 Länder anschlossen, darunter auch Österreich. Teufel: „Gerade in der heutigen Zeit, in der darüber diskutiert wird, ob man nicht viel zu schnell viel zu viele Länder in die EU aufgenommen hat, ist es ihm wichtig, dass damals ein geschichtlicher Augenblick genutzt worden ist, der zur Folge hat, dass wir bis heute in einer 70 jährigen Friedenszeit in Europa leben.“ Friede stellt für Teufel zwar einen Höchstwert dar, doch dazu gehörten Bürger- und Religionsfreiheit. Teufel hält den damit verbundenen Rechtsstaat für die größte Errungenschaft unserer Kultur und Geschichte. Zum Thema Religionsfreiheit bringt der ehemalige Ministerpräsident Hans Küng ins Spiel, zu dessen großen Errungenschaften auch das gegründete „Weltparlament der Religionen“ zählt, an dem über 1000 Repräsentanten teilnahmen und sich zu einem Weltfriedensprojekt bekannten. Teufel betont, dass es dabei eben nicht nur um Bekenntnis, sondern vor allem um die „Realisierung des Friedens“ in den einzelnen Gesellschaften gehe. Teufel abschließend: „Es ist wichtig, sich nicht von der Zerrissenheit Europas, die vermehrt über die Medien geschildert wird, verunsichern zu lassen, sondern sich auf die Substanz dessen, was in Europa erreicht worden ist zu besinnen und diese auch in Zukunft zu halten.“
Renoldner: Die katholische Kirche von heute hat bessere Chancen, demokratischer, sozial fairer und an der Seite der Menschen zu handeln als zwischen 1900 und 1945
Der oberösterreichische Theologe Severin Renoldner in seinem Vortrag „Katholische Kirche und österreichische Politik nach 1918. - „Christliche“ Politik neben Modernisierung und Demokratisierung“: „Die Katholische Kirche Österreichs musste im 20. Jahrhundert gewaltige Veränderungen verarbeiten. Vielfach unvorbereitet und auch überfordert musste es dabei zu Fehlern kommen, aus denen heute noch gelernt werden muss“, so Renoldner.
Renoldner weiter: „Die Kirche bestimmte in der Monarchie in weiten Bereichen die öffentliche Auffassung dessen, was als sittlich betrachtet werden muss. Sie hatte erheblichen Einfluss auf das Strafrecht, sie dominierte Schulen, Krankenanstalten und teilweise Universitäten. Umgekehrt war die Kirche in großer Abhängigkeit vom Kaiser und seinem Staat.
Mit der Republiksgründung von 1918 änderte sich das alles schlagartig.“ Nur zögerlich, erkannte die „offizielle Kirche“ die Chance, mit Hilfe der Christlichsozialen Partei den Anspruch zu stellen, dass die katholische Mehrheit auch von Abgeordneten einer streng kirchlich ausgerichteten Partei vertreten werden soll. Die Demokratie als solche wurde nicht innerlich bejaht. Anders im Kirchenvolk, wo es pluralere Ansichten gab! Eine große Abhilfe hätte hier die Katholische Soziallehre bieten können; dies wurde aber nur teilweise von der Pastoral genutzt. „Am ehesten lässt sich das im Sozialhirtenbrief von 1926 erkennen“, so Renoldner, der von 1991-96 auch als Abgeordneter zum Nationalrat tätig war.
Renoldner: Erfreulich, dass nach 1945 zweifellos wichtige Konsequenzen gezogen wurden
Das Abgleiten der 1. Republik in einen autoritären faschistischen Ständestaat wurde von der offiziellen Kirche ausdrücklich begrüßt. In Kauf genommen wurden die sozialen Härten und Grausamkeiten. Während die Aufarbeitung der Anpassung der österreichischen Kirchenleitung an den Nationalsozialismus 1938 intensiver Gegenstand der Debatte war und ist, wurde über diese wichtige Vorstufe meist geschwiegen.
„Gerne werden berechtigte und unberechtigte Milderungsgründe zu einer besonders diktaturfreundlichen Haltung vorgebracht: man sei unter Druck gestanden, habe Alternativen abwenden müssen mit schwerem Schaden z.B. für Priester usw. Dies soll alles berücksichtigt und gewichtet werden, aber nicht verdecken, dass die entscheidende Verantwortung auch übernommen werden muss“, meint der Theologe.
Renoldner weiter: „Der erfreuliche Ausblick geht dahin, dass nach 1945 zweifellos wichtige Konsequenzen gezogen wurden: in der Bejahung der Demokratie, im Mariazeller Manifest, im 2. Vatikanischen Konzil und einem neuen Selbstverständnis der Kirche in der Gesellschaft, nicht zuletzt in einer ökumenischeren Ausrichtung. Trotzdem sind diese wertvollen Änderungen nicht überallhin durchgeführt worden, wozu es auch einer gewissen Aufarbeitung der Geschichte bedurft hätte. Auch die mangelhafte innerkirchliche Demokratie und Reformbereitschaft mag dazu beitragen.“
„Die katholische Kirche von heute, mit allen Schrumpfungen, Sorgen und Bangigkeiten, hat aber bessere Chancen und echte Möglichkeiten, heute anders, besser, demokratischer, sozial fairer und insgesamt mehr an der Seite der Menschen zu handeln und zu sprechen als zwischen 1900 und 1945“, so Severin Renoldner abschließend.
Pelinka: Nicht christliche Politik machen, sondern Politik aus christlicher Verantwortung heraus
Der in Budapest tätige Politikwissenschaftler Peter Pelinka ging seinen Vortrag empirisch an. Denn nur die Erfahrung könne Grundlage für die Beantwortung der Frage sein: Christen in der europäischen Politik. Historische Belastung oder auch Chance für die Zukunft?
Im Nachhinein betrachtet habe das Christentum meist einen Strang verdrängt und beispielsweise nur das Positive betont, so Pelinka. Das „christliche Abendland“ habe sich in der Geschichte auch als eine „mörderische Erfahrung" dargestellt. Als Beispiele nannte der Politikwissenschaftler die Kreuzzüge, die Verfolgung von Häretikern, auch Hitler und Stalin seien nicht ganz von einem christlichen Hintergrund zu trennen. Eine wichtige Frage sei, was wird in 100 Jahren am heutigen christlichen Einfluss als Irrweg gelten. Viele Erkenntnisse im Christentum kamen erst sehr spät, so auch die Anerkennung der Meinungsvielfalt in der römisch-katholischen Kirche.
Nachdem sie in der Zwischenkriegszeit politisch völlig versagten und z.T. Mitschuld an der Machtübernahme der Nationalsozialisten gehabt hätten, wirkten Christliche Parteien zwar aktiv am europäischen Einigungsprozess mit; dennoch sei die Europäische Union kein christliches Projekt, da auch nicht-christliche Personen aktiv beteiligt waren. „Die Idee war keine christliche Föderation, die Grundlage war Religionsfreiheit“, so Pelinka.
Veränderung gab es durch das Verbot für den Klerus, in die Politik zu gehen. Europa dürfe keine christliche Politik machen, sondern „Politik aus christlicher Verantwortung heraus“, so Pelinka abschließend. Christlicher Antrieb sei legitim, aber kein christliches Programm.