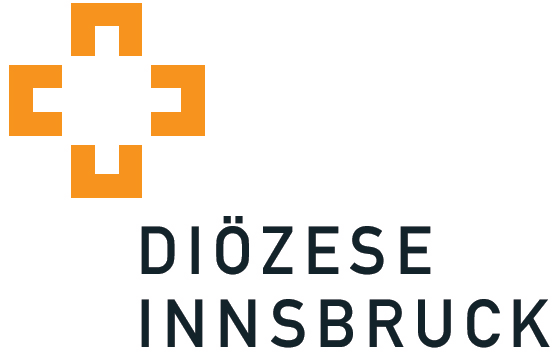Das Hirtenwort der Österreichischen Bischöfe
Liebe Schwestern und Brüder in Christus!
Am Beginn eines „Jahres des Glaubens“, das Papst Benedikt XVI. im Gedenken an das vor fünfzig Jahren eröffnete II. Vatikanische Konzil proklamiert hat, schreiben wir Ihnen diesen Brief. Dieses Jahr ist eine Einladung zur Belebung und Vertiefung unseres christlichen Glaubens. Die Seele dieses Glaubens ist die christliche Liebe: Liebe zu Gott und zu den Menschen. „Ich glaube dir, ich glaube an dich“ – das gehört zum Besten, das wir Menschen zueinander sagen können. Und diese Rede vollendet sich, wenn auch noch gesagt wird oder jedenfalls gemeint ist: „Ich liebe dich“. Ungemein vertieft gilt dies auch für unsere Beziehung zu Gott sowohl als einzelne Christen wie als Kirche im Ganzen.
Der Glaube zeigt sich am überzeugendsten durch die Freude, die er schenkt. Im Blick auf den Glauben heißt es im Ersten Petrusbrief: „Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren, und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprägt wurde und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen, und dennoch liebt ihr ihn; ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet: Euer Heil“ (1 Petr 1,6–9).
Wie schön wäre es, wenn wir, katholische Christen in diesem Land, sagen könnten: Diese Worte treffen auf uns zu! Ja, es gibt diese Momente „unsagbarer Freude“, die der gelebte Glaube schenkt. Sie sind „wertvoller als Gold“, denn sie stärken in uns die Gewissheit, dass wir im Glauben auf dem richtigen Weg sind. Und sie bezeugen anderen Menschen, dass der Glaube an Jesus Christus und die Liebe zu ihm dem Leben vollen Sinn gibt.
Aber da gibt es „mancherlei Prüfungen“, unter denen wir leiden müssen: persönliche, familiäre, berufliche, gesellschaftliche und auch kirchliche. Sie können die Freude am Glauben auf die Probe stellen, ihm den Schwung rauben, die Strahlkraft dämpfen. Heute wird viel von der Krise gesprochen, von der Eurokrise bis zur Kirchenkrise, von Ehe- und Beziehungskrisen bis zu Glaubenskrisen: „Dadurch soll sich euer Glaube bewähren“, sagt der 1. Petrusbrief.
Um die Bewahrung, die Bewährung, die Erneuerung, die Freude des Glaubens geht es uns, liebe Schwestern und Brüder, in diesem Hirtenwort zum „Jahr des Glaubens“, das unser Heiliger Vater, Papst Benedikt XVI., zum 11. Oktober dieses Jahres ausgerufen hat und das bis zum 24. November, dem Christkönigssonntag des Jahres 2013, dauern soll. Anlass zu diesem „Jahr des Glaubens“ ist der fünfzigste Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 11. Oktober 1962, und auch das zwanzigjährige Jubiläum der Veröffentlichung des Katechismus der Katholischen Kirche (KKK), den der selige Papst Johannes Paul II. am 11. Oktober 1992 promulgiert hat, um „allen Gläubigen die Kraft und die Schönheit des Glaubens vor Augen zu führen“ (Benedikt XVI., Porta fidei, Nr. 4.).
Um die Kraft und die Schönheit des Glaubens geht es also in diesem „Jahr des Glaubens“. Ist es dem großen Konzil gelungen, dies „der Welt“ und uns selber, den Gläubigen, vor Augen zu führen? Wie sind die fünfzig Jahre seit dem Konzilsbeginn verlaufen? Wie wurden sie von Euch, den Gläubigen, erlebt? In diesem halben Jahrhundert hat sich viel verändert, in der Welt wie in der Kirche.
Für die jüngere Generation, auch unter uns Bischöfen, ist das Konzil Geschichte. Nur die Älteren unter uns haben direkte Erinnerungen an die gewaltige Aufbruchsstimmung, die damals, zu Beginn des Konzils, herrschte. Viele der „Konzilsgeneration“ bedauern, dass, so empfinden sie es, der Aufschwung ausblieb, die vielversprechenden Ansätze später eingebremst wurden. Die Deutung der Entwicklung nach dem Konzil ist bis heute umstritten. War sie ein Aufbruch, war sie ein Niedergang? Und was hat den Aufbruch gehemmt, den Niedergang bewirkt? Oder gibt es Botschaften des Konzils, die wir zu wenig gehört haben, wie zum Beispiel den Ruf aller zur Heiligkeit?
Der Konflikt der Interpretationen, die Spannungen zwischen den verschiedenen Richtungen und Strömungen in der Kirche der letzten fünfzig Jahre haben immer wieder bis an den Rand von Spaltungen geführt, die innere Einheit der Katholischen Kirche auf Zerreißproben gestellt. So ist das Bild, das die Katholische Kirche in der Nachkonzilszeit der Welt geboten hat, oft ein nicht sehr anziehendes, meist weit entfernt von dem, was das Konzil als Vision von der Kirche der heutigen Welt zeigen wollte.
Da wir in einer mediengeprägten Zeit leben, kam erschwerend dazu, dass all die innerkirchlichen Konflikte im medialen Vergrößerungsglas noch viel größere Ausmaße annahmen. Die Missbrauchsskandale, die schwere Ärgernisse darstellen, haben die Glaubwürdigkeit der Kirche erschüttert. Zugleich ist nicht zu übersehen, dass sich die Lebensweise in unserem Land stark verändert hat. Ein nie gekannter Wohlstand vieler, die Konsumgesellschaft mit ihren Begleiterscheinungen haben sich auch auf die Glaubenspraxis in unserem Land ausgewirkt. Unsere Pfarren sind mit ganz neuen Gegebenheiten konfrontiert. Wir haben oft noch nicht den Weg gefunden dieser neuen Situation angemessen zu begegnen.
Wen wundert es, dass es in unserer Gemeinschaft viel Resignation und Frustration gibt, dass viele sich von der Kirche verabschiedet haben, und dass dieser meist lautlose Auszug aus der traditionellen Mehrheitskirche in unserem Land fast unvermindert anhält. So manche fragen sich besorgt: Wie wird es um die Katholische Kirche in Österreich stehen, wenn einmal des Hundertjahrjubiläums des Konzils gedacht werden wird?
1. „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht“ (Jes 7,9). Wir sehen nur eine Antwort auf die bedrängte Situation unserer Kirchengemeinschaft: den Glauben! „Ohne den Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird“ (Hebr 11,6). Der Glaube ist das Herz des christlichen Lebens. Er ist zuerst „eine persönliche Bindung des Menschen an Gott“ (KKK 150), ein Vertrauen des Herzens, eine Zustimmung des Verstandes und des Willens zu Gott, seinen Plänen und Wegen, seinem Willen und dem, was er uns in Jesus Christus geoffenbart hat. Wir sind alle auf Vorbilder des Glaubens angewiesen, auf die großen Gestalten der Heiligen, und auf die gläubigen Menschen, die unser Leben geprägt und den Weg unseres eigenen Glaubens gefördert haben. Der Hebräerbrief spricht von einer „Wolke von Zeugen“, die uns umgibt. Im Blick auf sie „wollen auch wir alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens“ (Hebr 12,1–2).
2. Zeugen sind gefragt. Wir Bischöfe sehen die Situation fünfzig Jahre nach Konzilsbeginn, neben allen sehr realen Schwierigkeiten, auch als eine große Chance. Denn wir sind als Glaubende ganz neu gefragt, von unserem Glauben Rechenschaft zu geben: Wofür stehst Du? Woran glaubst Du? Wem und wie glaubst Du? Und was bedeutet es für Dich persönlich, für Dein Leben, zu glauben? Je säkularer, je pluraler unsere Gesellschaft wird, desto mehr kommt es auf das persönliche Zeugnis an, und da tun sich immer mehr Türen auf, Türen für den Glauben. Wir erinnern hier an das bekannte Wort von Papst Paul VI.: „Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind“ (Evangelii Nuntiandi, Nr. 41).
In einer so vielschichtigen, vielgestaltigen Gesellschaft wie der unseren ist Auskunftsfähigkeit gefragt. Sind wir ausgerüstet, über unseren Glauben in einfachen Worten Rechenschaft zu geben? Der Grundwasserspiegel des religiösen Wissens ist in Österreich und in Europa stark gesunken. Elementare Kenntnisse, die zur europäischen Kultur gehören, können nicht mehr vorausgesetzt werden. Glaubenswissen ist aber eine der Voraussetzungen für ein glaubwürdiges Zeugnis. Daher die dringliche Einladung des Heiligen Vaters, dieses „Jahr des Glaubens“ zu nutzen, um unser Glaubenswissen zu vertiefen. Dazu gehört an erster Stelle die Liebe zur Heiligen Schrift. Papst Benedikt gibt uns ein leuchtendes Beispiel durch seine ganz am Wort Gottes orientierte Verkündigung. Dazu sollte in diesem Gedenkjahr des Konzils ein verstärktes Interesse an den Texten des Zweiten Vaticanums gehören. Wir begrüßen die vielen Initiativen in den einzelnen Diözesen, die der vertieften Kenntnis der Lehre des Konzils dienen. Dieser besseren Kenntnis sollte nach dem Wunsch der Außerordentlichen Bischofssynode von 1985, zwanzig Jahre nach Konzilsende, auch der „Katechismus der katholischen Kirche“ dienen, der eine Frucht des Konzils ist.
Es erfüllt uns österreichische Bischöfe mit Freude und ein wenig Stolz, dass das derzeit weltweit erfolgreichste katholische Buchprojekt unter unserer Herausgeberschaft erscheinen konnte: Der „Youcat“, derzeit bereits in über zwanzig Sprachen übersetzt, für Jugendliche und mit Jugendlichen erarbeitet, ist ein hervorragendes Instrument der Glaubensvertiefung, durchaus nicht nur für Jugendliche.
Zeugen des Glaubens zu sein, auskunftsfähig und gesprächsbereit: Das ist die Chance, die wir für uns alle heute sehen. Alle sind gefragt, es kommt nicht auf Spezialisten, auf Fachleute an, sondern zuerst und vor allem darauf, dass „die Liebe Christi uns drängt“ (2 Kor 5,14), das Evangelium zu bezeugen.
Überall in unserem Land sehen wir Anzeichen, dass dies in wachsendem Maß geschieht. An erster Stelle sind hierfür unsere Pfarrgemeinden zu nennen. Trotz mancher schmerzlicher Schrumpfprozesse, Rückgängen der Gottesdienstbesucher, geringerer Zahl an Kindern und Jugendlichen ist das landesweite Netz der Pfarrgemeinden ein einzigartiges Phänomen, das wir nicht kleinreden dürfen. Wir danken an dieser Stelle allen Frauen und Männern, die sich als Pfarrgemeinderäte und ehrenamtliche Mitarbeiter im Dienst der Kirche engagieren.
Wir bekennen uns zur Notwendigkeit und zur Zukunftsfähigkeit unserer Pfarrgemeinden, auch wenn wir uns ohne Angst den großen gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen stellen wollen, die auch unsere Pfarren und ihre seelsorglichen Strukturen betreffen.
Es ist gar nicht möglich, ein vollständiges Bild der Lebendigkeit der Kirche in unserem Land zu zeichnen. Wir sehen mit Freude die wachsende Zahl an Jugendgebetsgruppen im ganzen Land. Wir beobachten, dass die Zahl der jungen, gläubigen Familien zunimmt, die großherzig für mehrere Kinder offen und um ein echt christliches Leben bemüht sind. Auch wenn manche Ordensgemeinschaften schmerzliche Nachwuchssorgen haben, so sehen wir dankbar manche alte oder neue Ordensgemeinschaft aufblühen. Wir erleben ein beeindruckendes Engagement vieler Menschen im caritativen Bereich. Wir sehen, wie sehr unsere kirchlichen Bildungseinrichtungen gefragt sind.
Doch das Wichtigste am Glaubensleben entzieht sich jeder Statistik: die vielen Personen, die in ihrem Alltag eine tiefe Glaubensverbundenheit mit Gott leben, eine innige Christusnachfolge, ein stilles Sich-führen-lassen durch den Heiligen Geist. Sie sind die wahren Säulen der Kirche, sie tragen viel durch ihren Glauben mit. Sie sind wie jene vier Männer, die den Gelähmten gegen alle scheinbare Unmöglichkeit bis zu Jesus hingebracht haben: „als Jesus ihren Glauben sah…“ (Mk 2,5). Diese vielen Gläubigen in unserem Land sind unsere Zuversicht, unsere Hoffnung. Sie tragen auch heute durch ihren gelebten Glauben viele zu Christus! Sie alle sind die lebendige Kirche in Österreich, für die wir dem Herrn nicht genug danken können.
3. „Reformstau?“ Wir wollen nicht verschweigen, was vielfach uns gegenüber und auch öffentlich gesagt wird: dass es eine weit verbreitete Unzufriedenheit mit der Situation der Kirche und besonders mit „der Kirchenleitung“, mit uns Bischöfen und mit Rom, gibt. Hinter dieser Unzufriedenheit stehen meist tiefe Sorgen um den Weg, um die Zukunft der Kirche. Papst Benedikt XVI. hat in seiner beeindruckenden Predigt in der Chrisammesse am Gründonnerstag, als er auf den „Aufruf zum Ungehorsam“ einer Priestergruppe in Österreich einging, gezeigt, wie sehr er um diese Sorgen und Anliegen weiß. Dennoch haben viele Menschen in unserem Land den Eindruck, „es geht nichts weiter“, es bewege sich nichts. So hat sich das Schlagwort vom „Reformstau“ festgesetzt. Andererseits haben wir Bischöfe seit über einem Jahr immer wieder deutlich gesagt, dass ein „Aufruf zum Ungehorsam“ nicht unwidersprochen hingenommen werden kann. Bleibt es bei einer Art „patt-Situation“, in der sich dann nur mehr Beschuldigungen gegenseitig aufschaukeln? Wir sehen das „Jahr des Glaubens“ als eine vom Herrn angebotene Chance, gemeinsam aus scheinbaren oder wirklichen Sackgassen herauszufinden.
Die Sorgen, die hinter bestimmten „Reformforderungen“ stehen, sind uns gemeinsam. Viele bekümmert an erster Stelle der mangelnde Priesternachwuchs. In manchen Teilen unseres Landes wird der Priestermangel immer drückender spürbar. Weite Kreise unserer Bevölkerung, kirchlich gebunden oder nicht, verstehen nur schwer, warum zur Abhilfe dieser Notsituation nicht die Zulassungsbedingungen zum Priesteramt geändert werden, warum nicht verheiratete „bewährte Männer“ (viri probati) zu Priestern geweiht werden können. Sie meinen, dass wir österreichischen Bischöfe „Druck in Rom“ ausüben sollten, um eine Reform zu erwirken. Dabei wird aber meist übersehen, dass gerade das II. Vatikanische Konzil sich entschieden für die Beibehaltung des priesterlichen Zölibats für die römisch-katholische Kirche ausgesprochen hat, und dass alle Bischofssynoden seither immer wieder diesen Weg als für die Kirche gültig bestätigt haben. Darf darin nicht ein Zeichen des Heiligen Geistes gesehen werden?
Wir ermutigen daher dazu, den Zeichen nachzugehen, die Gott uns gibt, wenn etwa an manchen Orten, in manchen Gemeinden und Gemeinschaften die geistlichen Berufungen blühen. Ist es nicht sinnvoll, solche Beispiele näher anzusehen und zu fragen, was wir daraus lernen können? Wir sind überzeugt, dass Gott heute Priester beruft. Die Frage ist nur, ob der Humus da ist und gepflegt wird, auf dem diese Berufungen wachsen können.
Mit der Frage des Priesternachwuchses ist die Zukunft unserer Gemeinden eng verbunden. Es berührt uns Bischöfe tief, immer wieder zu erleben, wie sehr die Gemeinden sich Priester wünschen. Die Sorge ist groß: Was wird aus Gemeinden, die ihren Pfarrer immer weniger, immer kürzer sehen und erleben können? Aber müssen wir nicht gleichzeitig zugeben, dass das Leben unserer Gemeinden, besonders im ländlichen Raum, in den letzten fünfzig Jahren gewaltige Veränderungen erlebt hat? Die bäuerliche Bevölkerung ist stark zurückgegangen. Enorme Mobilität, starke Abwanderung und demographische Veränderungen haben das Leben unserer Gemeinden vor neue Herausforderungen gestellt. Der Priestermangel ist nur ein Aspekt davon, der „Gläubigenschwund“ ein anderer. Nur gemeinsam können wir diesen Übergang zu einer veränderten Kirchensituation gestalten. Entscheidend wird es sein, nicht nur die Verluste zu beklagen, sondern auf die Zeichen der Zeit zu achten, durch die Gott uns auf Seinen Wegen führen will.
Ein Element ist uns Bischöfen bei diesem Bemühen um die „Unterscheidung der Geister“ besonders wichtig: Wir wissen uns als Teil der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche. Wir wollen den Weg der Erneuerung und der Läuterung, auf dem wir uns befinden, bewusst in voller Gemeinschaft mit dem Papst, dem Nachfolger Petri, gehen, und in der vielgestaltigen Vernetzung mit der weltweiten Gemeinschaft der Kirche. Immer mehr wird unsere eigene Ortskirche Spiegel der Weltkirche durch die starke Immigration. Unsere vielen Brüder und Schwestern aus allen Teilen der Welt, die bei uns Arbeit suchen und Heimat finden, sind vollwertige Mitglieder unserer Ortskirche und nicht nur Gäste. Sie prägen und bereichern mehr und mehr das Leben der Kirche in Österreich.
Zugleich erleben wir nicht nur wirtschaftlich und politisch, dass die Bedeutung Europas abnimmt und neue Zentren in den Vordergrund treten. Auch kirchlich verlagert sich der Schwerpunkt von Europa weg. Die jungen Kirchen haben eine große missionarische Lebendigkeit, während uns bewusst wird, wie sehr wir selber Missionsland werden. Kein Wunder, dass man in vielen Teilen der Weltkirche über das erstaunt ist, was bei uns zum Hauptthema zu werden droht. Wir sind eingeladen, im „Jahr des Glaubens“ unseren Blick auf die weltweite Gemeinschaft der Kirche zu öffnen und davon Anregungen für unsere eigenen Prioritäten zu gewinnen. Auch bei uns muss die Kirche wieder missionarischer werden, sie muss neu „in unseren Herzen erwachen“ (Romano Guardini).
4. Die Eucharistie – Quelle und Höhepunkt. Ein zentrales Thema in den Debatten in unseren Diözesen ist die Zukunft der Eucharistiefeier, die das II. Vatikanische Konzil zu Recht als „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“ (Lumen Gentium, Nr. 11) bezeichnet. Wird diese Quelle allmählich versiegen? Wird dieser Höhepunkt des christlichen Lebens in Zukunft zur Seltenheit werden? Mit der Eucharistie ist der Lebensnerv der Kirche berührt. Ihr muss unser aller Sorge gelten.
Eine erste schmerzliche Feststellung drängt sich auf: Das Bewusstsein von der Wichtigkeit der Mitfeier der sonntäglichen Eucharistie ist in unserem Land zurückgegangen, in einer kontinuierlichen, unaufhaltsamen Abwärtsbewegung seit fünfzig Jahren. Wir alle wissen das. Wir rätseln über die Ursachen. Wir leiden darunter. Nicht überall, Gott sei Dank, aber unleugbar im Gesamttrend.
Eine zweite Feststellung ist notwendig. In den letzten Jahrzehnten gibt es die Tendenz zur Häufung der Eucharistiefeiern: Abendmessen am Sonntag, Vorabendmessen am Samstag, dazu Festmessen, Feldmessen, Gruppenmessen. Verloren gingen dabei vielfach andere Gottesdienstformen wie Andachten, Prozessionen, Anbetungszeiten. In nicht wenigen Gegenden unseres Landes erleben wir heute eine Vielzahl von Messfeiern mit jeweils vergleichbar wenigen Gläubigen. Und wo keine Eucharistiefeier mehr möglich ist, werden lieber Wortgottesfeiern gehalten, als sich mit seiner Nachbargemeinde zur Eucharistiefeier zusammenzufinden.
Es ist uns bewusst, dass die Lösung dieser konfliktträchtigen Situation nicht in einem bloßen Entweder – Oder liegen kann. Doch gibt es eine klare Priorität, für die einzustehen uns die ganze christliche Tradition und die jahrhundertelange christliche Lebenserfahrung verpflichtet und die auch das Konzil bekräftigt hat. Deshalb halten wir daran fest, dass die eigentliche liturgische Feier des Sonntags, des Herrentages, die Feier der Eucharistie ist, der ein geweihter Priester vorsteht. Die Grenze zwischen Eucharistiefeier und Wortgottesfeier darf nicht verwischt werden. Hier steht die Einheit der Kirche auf dem Spiel. Nichts kommt der Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn gleich, die uns in der Eucharistie geschenkt wird.
Uns sind die Einwände bekannt und bewusst: Was wird aus den Gemeinden vor Ort, wenn nicht mehr wenigstens ein Wortgottesdienst am Sonntag gefeiert wird? Zeigt nicht gerade die unvergleichliche Bedeutung der Eucharistie, dass es genügend geweihte Diener der Eucharistie geben muss, damit die Gemeinden nicht „eucharistisch aushungern“?
Doch werfen gerade diese Einwände auch wieder die Gegenfrage auf: Wie steht es um den Hunger und Durst nach der Eucharistie? Müssen sie nicht wieder neu erwachen? Erinnern uns unsere Nachbarländer mit ihrer Erfahrung der kommunistischen Verfolgung nicht daran, dass es Zeiten gegeben hat, in denen Gläubige größte Opfer auf sich genommen haben, um an einer vielleicht weit entfernten und geheimen Eucharistiefeier teilzunehmen? Zeigen uns die Christen in den Ländern zunehmender islamischer Verfolgung nicht neu den Wert der Sonntags- messe, wenn sie sich nur unter Lebensgefahr dazu versammeln können? Heißt es nicht in der ältesten uns erhaltenen Beschreibung der Eucharistiefeier der Christen, beim hl. Justin dem Märtyrer (um 155): „An dem nach der Sonne benannten Tage findet die Zusammenkunft von allen, die in den Städten oder auf dem Lande herum weilen, an einem gemeinsam Ort statt“ (vgl. KKK 1345). Papst Benedikt erinnert daran, dass die „Erfahrung des Miteinanderseins“, die „Pflege der Dorfgemeinschaft“, so wichtig sie sind, nicht über der „Gabe des Sakraments“ stehen dürfen, durch das Christus in unvergleichlicher Weise die Gemeinschaft und den Menschen „erbaut“.
Liebe Brüder und Schwestern! Es wird in Zukunft beides brauchen: möglichst lebendige Gebetsgemeinschaften vor Ort, getragen von den Gläubigen, unterstützt von ehrenamtlichen Laien und Katecheten, von hauptamtlichen Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten, von Diakonen, Priestern und dem verantwortlichen Pfarrer. Und es wird die gemeinsame Eucharistiefeier, vielleicht von mehr als nur einer Gemeinde, als Herzstück des Sonntags brauchen. Ist nicht das „Jahr des Glaubens“ gerade eine Chance, unseren eucharistischen Glauben zu vertiefen, das „Geheimnis des Glaubens“ und seine lebensverwandelnde Kraft neu schätzen und lieben zu lernen?
5. Ehe und Familie – die Zukunft. „Das Wohl der Person sowie der menschlichen und christlichen Gesellschaft ist zu innerst mit einem Wohlergehen der Ehe- und Familiengemeinschaft verbunden.“ Diese Worte des Konzils (Gaudium et Spes, Nr. 47,1) finden heute, nach fünfzig Jahren, nach wie vor breite Zustimmung, auch in der säkularen Gesellschaft. In den Jugendstudien zeigt sich, dass für die junge Generation die Werte von gelingenden Ehe- und Familienbeziehungen an oberster Stelle stehen. Die Sehnsucht nach guter und treuer Partnerschaft und nach Familie ist unverändert groß. Sozialwissenschaftler weisen warnend darauf hin, dass in Zeiten eines schwächer werdenden Sozialstaates das sicherste Auffangnetz eine große Familie darstellt.
Wir wissen aber auch, wie brüchig dieses Netz, wie krisenanfällig die Beziehungen in Ehe und Familie sind. Angesichts vielfältiger Situationen von Scheidung, Wiederverheiratung, unverheiratetem Zusammenleben und anderem mehr wird seit langem der drängende Ruf laut, die Kirche möge diesen Situationen mehr entgegenkommen, barmherzige Lösungen zulassen. Auch hier wird „Reformstau“ geortet. So ergibt sich oft eine paradoxe Situation: „Weltliche“ Stimmen appellieren, die Wichtigkeit von Ehe und Familie für den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sehen und zu schützen. „Kirchliche“ Stimmen fordern eine „offenere“ Praxis im Umgang mit Situationen des Scheiterns und Neuanfangs.
Dieses Hirtenwort zum „Jahr des Glaubens“ kann keine einfachen Rezepte, keine fertigen Lösungen vorlegen. Wir bitten nur herzlich Euch alle, Brüder und Schwestern, um ein gemeinsames Bemühen, die Situationen vor allem im Licht des Glaubens zu sehen. In diesem Licht erscheinen Ehe und Familie zuerst als von Gott gewollte und geheiligte Wege. Ohne den Glauben ist es daher auch nicht möglich, Jesu Worte anzunehmen, die die Unauflöslichkeit der Ehe begründen: „Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen“ (Mt 19,6). Jesus selber hat den Jüngern gegenüber betont: „Nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist“ (Mt 19,11).
Oft wird „der Kirche“ Unbarmherzigkeit vorgeworfen, wenn sie versucht, die Treue zur Weisung Jesu gegen alles Unverständnis unserer Zeit zu wahren. Viel zu wenig wird darauf hingewiesen, dass Jesu Worte über die Unauflöslichkeit der Ehe aus Seinem Erbarmen mit uns Menschen kommen und dass viel Leid, viele Verletzungen, auch viel Unbarmherzigkeit durch unsere Untreue Seinem Wort gegenüber entstehen, unter denen Partner, Kinder, ganze Familien oft schwer zu leiden haben.
Die Kirche ist oft auf einsamem Posten in unserer Gesellschaft, wenn sie Ehe und Familie beschützt und verteidigt. Sie tut es aus Barmherzigkeit und nicht aus Härte. Aber sie hat sich auch immer neu an Jesu Haltung den Sündern gegenüber zu orientieren, die die Sünde benennt, dem Sünder aber voll Barmherzigkeit begegnet. Jesus lässt auch die, deren Beziehung in Brüche gegangen ist, nicht alleine zurück. Durch den Glauben schenkt er Heilung und Neuanfang.
Wie aber, so wird oft zu Recht gefragt, soll dies praktisch aussehen: die Sünde als Sünde sehen und benennen und doch mit dem Sünder barmherzig sein? Hier werden oft von uns Rezepte erwartet, die wir nicht geben können, generelle Lösungen, die mit den klaren Worten Jesu und mit der Treue zur Lehre der Kirche unvereinbar sind. In unseren Diözesen bemühen wir uns, einen Weg der Klarheit und auch der Milde, der Treue und der Barmherzigkeit zu gehen. Wenn uns vorgeworfen wird, dies sei unehrlich oder gar die Förderung einer Doppelmoral, so schmerzt das.
Wir können und wollen nicht aufgeben, was der Herr selber seiner Kirche als klare Weisung gegeben hat. Wir müssen daran erinnern, dass seine und der Kirche Strenge Ausdruck seiner Barmherzigkeit ist, die uns vor Irrwegen und Schäden bewahren will. Wir wissen aus reicher Erfahrung, dass die Treue zu Gottes Geboten Opfer abverlangen kann, dass aber diese Opfer oft große Fruchtbarkeit erwirken. Johannes der Täufer hat sich nicht gescheut, seinem König die Wahrheit über seine unerlaubte Ehe zu sagen. Er hat es mit dem Martyrium bezahlt, das am Beginn des Wirkens Jesu steht (vgl. Mk 1,14; 6,17–29). Jesus selber aber hat jeden von uns auf unsere eigenen Sünden verwiesen („Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie“), um dann der Ehebrecherin zu sagen: „Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr“ (Joh 8,1–11).
Diese Spannung zwischen Wahrheit und Barmherzigkeit werden wir immer neu auszuhalten haben. Es gibt keine echte Barmherzigkeit ohne Wahrheit. Aber Wahrheit, die ohne Barmherzigkeit gesagt und gefordert wird, ist kein Zeugnis für Christus. Dem hl. Franz von Sales, dem gütigen Bischof, wird das Wort in den Mund gelegt: „Man fängt mehr Fliegen mit einem einzigen Tropfen Honig als mit einem ganzen Fass Essig.“
6. Gemeinsam im Glauben. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! Ein Hirtenwort kann nicht alle Fragen ansprechen und schon gar nicht alle Probleme lösen. Aber wir hoffen, dass es dazu beitragen kann, unser gegenseitiges Wohlwollen zu stärken, das Band der Einheit in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, in unseren Diözesen und mit dem Papst. Wir verstehen, dass viele ungeduldig sind, Änderungen erwarten, ja fordern, ohne zu bedenken, dass manche der geforderten Änderungen nur um den Preis des Bruches der Kirchengemeinschaft möglich wären und nur scheinbar den Menschen zum Wohle dienen. Gerade die Kirchengemeinschaft zu wahren und zu fördern ist aber Aufgabe des Bischofsamtes.
Wenn wir zum „Jahr des Glaubens“ zur Verlebendigung des Glaubens und zur Vertiefung des Glaubenswissens aufrufen, so ist das keine Ablenkung vom Aufruf zur Kirchenreform, sondern deren Inangriffnahme. Nur aus dem Glauben kommt die Erneuerung der Kirche. Nur Gläubige und ihres Glaubens frohe Menschen können andere zum Glauben motivieren. Wenn wir im Glauben brennen, wird unsere Kirche wieder leuchten und wärmen und andere entzünden.
Wir bitten Maria, die von Elisabeth selig genannt wurde, weil sie geglaubt hat (vgl. Lk 1,45), Gott für uns, für Österreich zu bitten, dass der Glaube wachse. Mit ihr gemeinsam bitten wir den Herrn Jesus Christus für die Kirche in Österreich: „Stärke unseren Glauben“ (Lk 17,5).
Die österreichischen Bischöfe
Wien, im September 2012