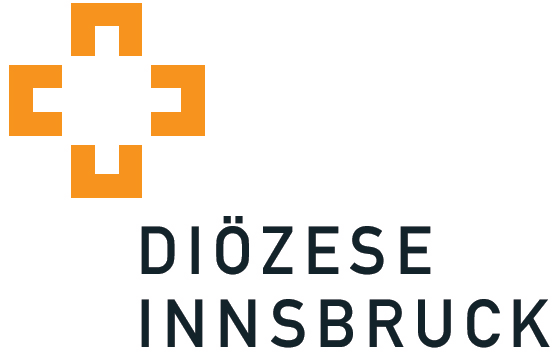Bischof Scheuer: Friede braucht Gerechtigkeit und Entwicklungshilfe
(KAP) Friede meint mehr als das bloße Schweigen von Waffen: Friede kann vielmehr nur auf Dauer gewährleistet werden, wenn es gelingt, Gerechtigkeit für die Ärmsten zu schaffen. Das hat der Innsbrucker Bischof Manfred Scheuer bei einem Vortrag in Wien betont. Aus diesem Grund sei die kirchliche Friedensarbeit eng verzahnt mit dem kirchlichen Einsatz "für eine gerechte Gestaltung der Wirtschaftsordnung", mit der "Option für die Schwachen", mit ihrem Einsatz für die Menschenrechte und Religionsfreiheit sowie mit ihrem Drängen auf Einhaltung der Zusagen in der Entwicklungszusammenarbeit.
Heute sei der Kampf für den Frieden und gegen Terror und Gewalt vor allem "präventiv" zu führen, mahnte Scheuer. Das bedeute etwa, dass man sich fragen müsse, inwiefern die finanziellen Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe angesichts aktueller Krisenherde ausreichten: "Es besteht eine massive Diskrepanz zwischen den Militäreinsätzen im Irak, im Kosovo, in Ruanda, im Sudan, in Afghanistan einerseits und jenen bescheidenen Mitteln andererseits, die nach heftigem Ringen für den Stabilitätspakt und den Wiederaufbau bereitgestellt wurden", mahnte Scheuer.
Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit seien spätestens durch die maßgebliche Friedensenzyklika "Pacem in terris" von Papst Johannes XXIII. (1958-1963) zu Leitbegriffen der kirchlichen Friedensarbeit geworden, so Scheuer weiter. Unter Papst Johannes Paul II. und den Eindrücken des Falles des Eisernen Vorhangs 1989 seien diese Prinzipien schließlich in den Einsatz für Menschenrechte, Religionsfreiheit und soziale Gerechtigkeit übersetzt worden: "Friedensarbeit beinhaltet Freundschaft mit den Armen, Entwicklungshilfe wie humanitäre Hilfe, Aufbau eines sozialen Umfelds, wo große Spannungen herrschen."
Das kirchliche Friedensengagement könne man in all seinen komplexen Verstrickungen schließlich unter dem Begriff des "Friedensopfers" zusammenfassen, so Scheuer weiter. Zwar sei der Opferbegriff gerade auch im religionsgeschichtlichen Kontext brisant und mitunter belastet, wie Scheuer mit biblischen Beispielen ebenso verdeutlichte wie mit Verweisen auf die Opfer-Terminologie der Nationalsozialisten; dennoch weise gerade der Blick auf das Kreuzesopfer Jesu über ein allzu enges Opferverständnis hinaus: So stelle der Kreuzestod Jesu einen "Akt der radikalen Feindesliebe uns Menschen gegenüber" dar - und damit werde er zum Vorbild allen kirchlichen Bemühens um Frieden: "Der Schrei der Opfer der Weltgeschichte geht damit nicht ins Leere", so Scheuers Interpretation, sondern er provoziere Solidarität und Nächstenliebe.
Der Vortrag bildete den Abschluss des Studientages "Kriegsopfer - religiöses Opfer - Spuren archaischer Religiosität" im Wiener Jakob Kern-Haus. Der Studientag fand im Rahmen der breit angelegten interreligiösen Veranstaltungsreihe "1914 - Frieden - 2014" auf Einladung des Instituts "Friede", des Instituts für Religion und Frieden sowie in Kooperation mit der "Journalists and Writers Foundation" und dem "Forum für Weltreligionen" statt.
NS-Opferbegriff "menschenverachtend"
Neben Scheuer referierte u.a. auch der Leiter des Instituts für Religion und Frieden (IRF), Bischofsvikar Werner Freistetter, bei dem Studientag. Dabei warnte Freistetter anhand des Beispiels des Nationalsozialismus vor einer Engführung des Opferbegriffs. Der Opferdiskurs in jener Zeit habe keine religiöse Dimension angesprochen, sondern vielmehr die Säkularisierung vorausgesetzt, etwa wenn göttliche Eigenschaften auf Nation, Volk oder das Konstrukt der arischen Rasse übertragen und als "Höchstwert"
bezeichnet wurden.
Opfer im Sprachgebrauch des Nationalsozialismus seien auf die Gemeinschaft bezogen gewesen - als "Mensch, der sich - idealerweise im Kampf - für das Volk, für die Rasse, für den Führer opfert". Ebenso wie die nationalsozialistische Ideologie sei auch deren Opferbegriff "menschenverachtend und zerstörerisch" gewesen, sichtbar an ihrer Stilisierung von allem zum "Opfer"- auch etwa des Sterbens der Toten im Luftkrieg. Freistetter: "Dahinter stand die Idee, dass der Einzelne nichts und das Volk alles sei."
Die Geschehnisse im Nationalsozialismus seien eine Warnung, dass die religiösen Werte in der richtigen Ordnung sein müssen, so der Bischofsvikar, würde andernfalls doch "das Höchste zum Schlimmsten und Zerstörerischsten verkehrt". Weitere Referenten waren der Geschäftsführer des Forums für Weltreligionen, Petrus Bsteh, sowie Christoph Ebner vom Heeresgeschichtlichen Museum und Mustafa Cenap Aydin vom Tevere-Institut in Rom.