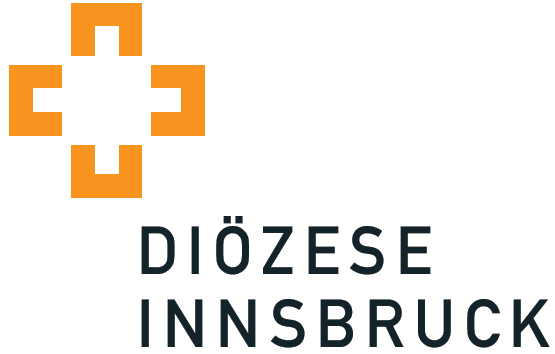Osterpredigt von Bischof Hermann Glettler
Wir erleben eine vielfach „sprechende Liturgie“ – österliche Lieder, Symbole, Gesten – und eine anspruchsvolle Kirchenmusik. All das kommt uns zu Hilfe, denn das Geheimnis von Ostern lässt sich kaum in Worte fassen. Es bleibt ein Stammeln. Wir haben soeben die wuchtige Oster-Predigt des Petrus gehört. Vor den Offizieren der römischen Besatzungsmacht hat er von Jesus, dem lebendigen Christus gesprochen, dessen Leben, Sterben und Auferstehen ein Geschenk Gottes für alle (!) Menschen ist. Ohne Vorbehalte. Ähnlich starke, von Erfahrung gesättigte Reden, Proklamationen des Lebens brauchen wir auch heute, aber ebenso Zeichen und eine österliche Körpersprache.
Eine Sprache mit österlicher Erfahrung
Die Jünger tun den Bericht der Frauen vom leeren Grab als „Geschwätz" ab. Aber was soll man/frau denn sagen, wenn das Geschehen zu groß ist, überwältigend und unfassbar? Denken wir an das größte Ereignis, die Liebe zwischen zwei Menschen, oder an eine hereingebrochene Trauer. Auch das Erstaunen vor der Urgewalt der Natur kann sprachlos machen. „Wow! Unfassbar! Geil! Voll cool! …!“ Nur mehr Urlaute, weil die Sprache versagt. Alles nur Geschwätz? Das Versagen der Sprache kann aber auch Ausdruck eines unerlösten Herzens sein. Dann ist unser Reden tatsächlich leer, spöttisch oder zynisch – ohne es zu merken, sprechen wir nur mehr von unserer Enttäuschung, von der Bitterkeit und Frustration, die sich in uns eingeschlichen hat. Oder wir sind mit unseren Worten verurteilend, hart im Gericht mit Anderen, besserwissend und überlegen. Ein Problem unserer Zeit.
Wie also fühlt sich eine österliche Sprache an? Sie kommt mit Sicherheit aus einem erlösten Herzen und nicht aus einem verschlossenen Grab. Österlich geprägtes Reden ist ein befreites Reden – ohne den Zwang, alles beurteilen zu müssen. Es trägt in sich eine dankbare Freude über das Leben, über das, was gelingt, und nicht über das, was es an Übel und Missständen immer geben wird. Österliche Gespräche sind wie Spaziergänge, wo das Miteinander-Gehen unerwartet zwanglos in die Tiefe von Lebenserfahrungen führen kann. Sie zu teilen, berührt. Alles nur Geschwätz? „Jesus lebt! Er ist auferstanden!“ Diese schönen Worte einer tiefen Ostergewissheit werden leicht zu Floskeln, abgelutscht durch ein seichtes Frömmigkeits-Geschnatter. Aber nicht davon reden – die Größe und Schönheit von Ostern nicht zur Form und zum Inhalt unserer Kommunikation machen? Den lebendigen Christus verschweigen, dem jeder begegnen kann – tröstend und heilend inmitten aller Verwundungen unserer Zeit? Manchmal müsste uns doch der Mund übergehen!
Natürlich kann man die Osterbotschaft nicht wie Verlautbarungssätze vor sich her tragen. Phrasen, die einer religiösen Propaganda gleichen, verraten das zärtliche Geheimnis. Aber vielleicht ist die Unbeholfenheit in der Sprache ein Zeichen, dass wir die revolutionäre Botschaft noch nicht verinnerlicht haben. Bevor wir vom Auferstandenen reden können, muss er in uns angekommen sein. Es geht im österlichen Zeugnis um eine Ansage gegen den Tod! Ganz egal, wie professionell oder holprig dies ausgedrückt wird, aber deutlich muss es sein – hineingesagt in eine erschöpfte, den Tod als Niederlage, als definitive Enttäuschung fürchtende Wohlstandsgesellschaft. Die Ansage von Ostern ist natürlich kein Überreden, kein Übertrumpfen mit den stärkeren Argumenten. Die Osterbotschaft dürfen wir aber auch nicht nur einer klugen theologischen Argumentation überlassen. Ostern ist eine Ansage von Leben! Dem entspricht keine Theorie, sondern nur das lebendige Zeugnis.
Ein „Leiberl" gegen den Tod
„A Leiwal hom“ oder gegen einen übermächtigen Gegner eben „ka Leiwal hom“ ist als Redewendung Wienerischer Mundart bekannt. Übersetzt gemäß seiner ursprünglichen Bedeutung: Nicht eingesetzt werden, nicht von der Partie sein, weil die Anzahl der Mitspielenden und damit die Leiberl begrenzt vorhanden sind. Davon abgeleitet: Gegen einen sportlichen Gegner keine Chance haben. Auf Ostern bezogen: Das Spiel war für die Elf verloren. Ihr langjähriger Trainer, ihr „Lebemensch“ und göttlicher Sponsor war tot. Es war für die gesamte Mannschaft alles vorbei. Doch dann taucht er plötzlich auf. Das entscheidende Spiel soll also nicht verloren sein? Woher die Gewissheit und wie davon sprechen?
Ich möchte eine Begebenheit schildern, die uns mit jugendlicher Kreativität das Ostergeheimnis erschließt. Für das Begräbnis ihres Bruders Dominik, der im Alter von 16 Jahren an Lungen- und Leberkrebs nach drei Jahren Kampf verstarb, trug seine Schwester Sara ein orange-gelbes T-Shirt. Sie ist 19 Jahre alt und hatte mit ihrem Bruder eine enge geschwisterliche Verbindung. Bevor sie in der Kirche ans Rednerpult trat, um die Lesung vorzutragen, zog sie ihre Jacke aus, sodass alle das bunte Kleidungsstück sehen konnten. Sara wusste um den tiefen Glauben ihres Bruders, sie kannte aber auch sein Ringen in der letzten Zeit, weil er das Leben liebte. „Ich trage bewusst dieses Auferstehungs-T-Shirt. Ich weiß, dass es Dominik gefällt.“ Sie hat zur Überraschung aller ein Zeichen gesetzt und damit ein „sprechendes“ Zeugnis gegeben. Danke Sara!
Im leeren Ostergrab von Jerusalem lagen die verwendeten Textilien ordentlich zusammengelegt. Kein Chaos, keine Unordnung, die an einen Todeskampf oder ein Verwesen erinnert. Ostern bringt eine neue Ordnung. Anstelle der Schmutz-Wäsche der Umkehr, Reue und Vergebung gibt es jetzt eine neue Kleidung. Wir haben in der österlichen Taufe den lebendigen Christus wie ein Kleid angezogen. Ein weißes Kleid, das den Lichtglanz der Auferstehung widergibt. Das Taufkleid ist das eigentliche Auferstehungs-T-Shirt. Ein sprechendes Zeichen, um die Osterbotschaft zu „verstehen“. Wichtiger noch als diese österlichen Zeichen ist die Körpersprache der Kirche. Ist sie österlich? Körpersprache meint die Summe von Gesten und Signalen, Habitus und Haltungen einer Person oder Institution.
Die österliche Körpersprache
Österliche Körperhaltung kommt im Hingehen und Nachschauen zum Ausdruck: Die Osterbotschaft kann nicht als Pressemitteilung versandt werden. Sie muss persönlich überbracht werden – mit Freude und ungekünsteltem Interesse an Begegnungen. Hingehen und nachschauen, wie´s geht. Was beschäftigt meinen Nachbarn, meine Arbeitskollegin, meinen Mitarbeiter? Und noch viel näher: Wie geht es meiner Familie, meinem Partner, meiner Frau? Eine lebendige Kirche lebt von vielen österlichen Botschaftern, die auch zu jenen gehen, die leicht übersehen werden. Konkrete, oft auch eine „hässliche“ Not, eine schwierige psychische Verfassung oder harte Schicksalsschläge machen diese Menschen und Adressen gerade nicht attraktiv. Dieses Aufsuchen kommt ohne großes Gerede aus, aber es ist ein lautes Signal der österlichen Liebe. Eine österliche Sprache der Kirche.
Zur österlichen Körpersprache gehört zweitens die Freude. Es gibt genügend Anlässe, Ereignisse und Geschichten des Gelingens, die wertvolle österliche Spurenelemente in sich tragen. Diese Elemente müssen Raum bekommen. Der Freude Raum geben! Wir dürfen nicht ständig auf die Grabeslöcher hinstarren, auf das Versagen und Mühsame. Bleiben wir doch in der Freude, sie ist die Lebenskraft, die Gott schenkt! Oftmals am Tag braucht es das Benennen und sich Mit-Freuen, wenn etwas gut läuft. Diese Grundhaltung gilt auch für unsere Gottesdienste. Niemand verlangt eine Perfektion in der „liturgischen Performance", aber eine grundsätzliche Freude schon. Sie bezeugt Ostern.
Offenheit, Dialog und Geduld, möchte ich als dritte österliche Körperhaltung nennen. Wir alle gehen einen Weg des Glaubens. Suchen, Zweifel, kritisches Angefragt-Werden gehören dazu. Es ist ein Dienst, den wir ungefragt genügend oft erhalten. Die konstruktive Kritik der Menschen, wohlgemerkt nicht die Jammerei oder Miesmacherei, sind heilsam für die Gesamtgestalt von Kirche. Und wenn es Strukturen oder unerlöste Haltungen sind, die wir zu ändern haben, dann laßt uns dies tun. Im Geist von Ostern gibt es eine Zuversicht, die stärker ist als ein vorschnelles Verteidigen und Rechtfertigen. Gehen wir gemeinsam mit möglichst vielen Menschen einen Weg! Österlich lebend und sprechend!
Predigt von Bischof Hermann Glettler am Ostersonntag, 21. April 2019, Dom von Innsbruck