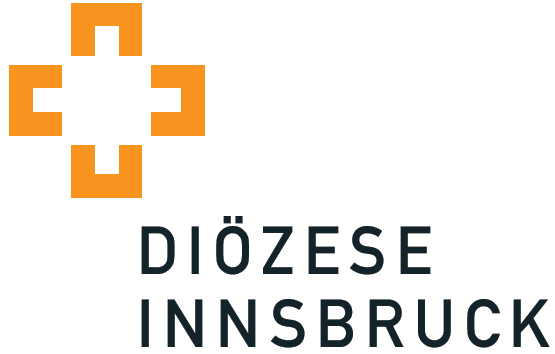Die Herzen werden nicht dement – Ethikforum 2024
„Deine Demenz und wir – Familien im Ausnahmezustand“ – so lautete der Titel des Ethikforums 2024. „Wahre Expert:innen“ sollten dabei zu Wort kommen - die pflegenden Angehörigen, deren Leben durch die Diagnose Demenz komplett auf den Kopf gestellt wurde. Mit ihnen diskutierte die Fachexpertin und Leiterin der Sevicestelle für pflegende Angehörige der Caritas (Erzdiözese Salzburg) Katja Gasteiger. Von ihrem bisherigen Weg gemeinsam mit ihren Partner:inen, die an Demenz erkrankt sind, berichteten die Pflegenden eindrücklich.
Fürsorge und Selbstfürsorge
Susanne har ihren Job aufgrund der Krankheit ihres Mannes verloren, aber dadurch auch ihren neuen Job gefunden: als Demenzberaterin bei der Caritas der Erzdiözese Salzburg. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie die Selbsthilfegruppe „der Garten“ gegründet. Das Erkennen eigener Ressourcen, Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit können in der Gruppe reflektiert werden und die pflegenden Angehörigen sind einander eine große Stütze.
Elisabeth erzählt von ihrem „Minutenurlaub“. Sie pflegt ihren Mann und ihren Sohn; an „guten Tagen“ genießt sie jede Minute, sie machen einen kleinen Ausflug und erfreuen sich an der Natur.
Auch Gilbert schätzt den Austausch in der Gruppe, er besucht das Demenzcafe TrotzDem. Gemeinsam mit seiner Frau geht er auch manchmal zu Konzerten in Innsbruck; zwar vermisst er es am nächsten Tag mit seiner Frau über das Erlebte zu sprechen, doch er weiß, sie teilen die Freude an der Musik.
Der „mental load“ ist die größte Belastung
Der Großteil der an Demenz Erkrankten wird zuhause gepflegt (sehr häufig von Frauen). Was braucht unsere Gesellschaft, damit es bewältigbar bleibt? Die Menschen in Österreich werden älter, auch die Diagnosezahlen steigen. Mobile Pflege und die Hilfe von Menschen im eigenen Umfeld (Freiwillige, Freunde…) entlastet zwar, aber die pflegenden Angehörigen tragen weiterhin die Last der Organisation. „Sie müssen 24 Stunden für einen anderen Menschen denken. Der ‚mental load‘ ist die größte Belastung!“, so Katja Gasteiger. Individuell angepasste Pflegepläne sind notwendig, pflegende Angehörige dürfen nicht mit schlechtem Gewissen konfrontiert werden, wenn sie die demenzkranke Person irgendwann ins Pflegeheim bringen. Fast jeder Mensch mit Demenz braucht irgendwann eine stationäre Pflege im Heim. Die Demenzfachfrau rät außerdem frühzeitig über die Vorgangsweise bei fortschreitender Krankheit zu sprechen. Auch gesunde Menschen sollten mit ihren Familien darüber sprechen, wie sie mit einer eventuellen bewusstseinsverändernden Krankheit innerhalb der Familie umgehen. „Der Krankheit immer einen Schritt voraus sein“, das ist das Wichtigste.
Die Gefühle werden nicht dement
Auch wenn der an Demenz erkrankte Partner fast nicht mehr sprechen kann – so berichten die beiden Frauen an diesem Abend – können die Paare trotzdem kommunizieren. Nach jahrzehntelanger Ehe verstehen sie sich auch ohne Worte. „Mein Mann spürt auch wie es mir geht. Reden kann er nicht mehr, aber wir sind uns trotzdem nah.“
Diese ehrlichen Erfahrungsberichte haben den Abend so unvergleichlich und eindrücklich gemacht. Angelika Stegmayer – die Moderatorin des Abends – bedankte sich bereits zu Beginn, dass „wir Ihnen heute Löcher in den Bauch fragen dürfen“. Das durfte dann auch das Publikum in der abschließenden Diskussion und im Anschluss daran an der Bar.
Das Herz wird nicht dement und die Gefühle auch nicht – die Podiumsgäste berichteten voller Liebe über ihre zu pflegenden Angehörigen und zeigten eine unglaubliche Stärke im Einsatz für die zu Pflegenden, aber auch für sich selbst. Bischof Hermann nannte den Abend zum Abschluss eine „Nachhilfestunde in Menschlichkeit“! Und diese Nachhilfe werde gesellschaftlich in Zukunft weiterhin notwendig sein.
Von Magdalena Collinet