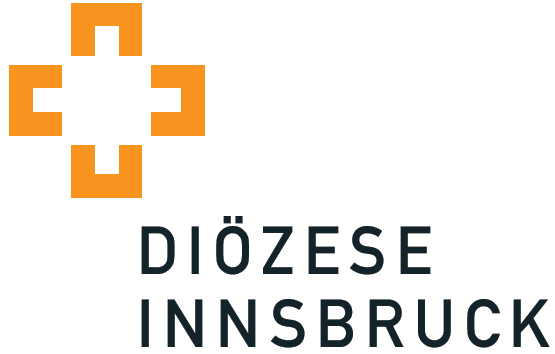Bischof: Zeitgenössicher Kunst in Kirchen Gastfreundschaft geben
Für weniger Empörung in Debatten über zeitgenössische Kunst in der Kirche plädiert Bischof Hermann Glettler. "Provokation um ihrer selbst willen, ist unerträglich. Wenn jedoch qualitätsvolle Kunst provoziert, dann muss es wohl so sein", sagte Glettler der "Neuen Südtiroler Tageszeitung" (Samstag). Alte und neue Kunst könne Menschen "aus der Zerstreuung sammeln und zutiefst berühren". Entsprechend appelliert der Innsbrucker Bischof zu "Gastfreundschaft" für zeitgenössische Kunst in Kirchen, aber auch zum Wiederentdecken der "Kraft und Schönheit" älterer kirchlicher Kunst. Die Beschäftigung mit der Kultur unserer Zeit könne den Boden für die wichtigste Kulturarbeit der Kirche bereiten, hielt Glettler fest: die Verkündigung des Evangeliums. "Es ist ein permanenter Übersetzungsprozess."
Gläubige sollten sich auch in Diskussionen um eine Verletzung religiöser Gefühle "nicht zu schnell in die Ecke der Beleidigten treiben lassen", rief Glettler in dem längeren Interview auf. Besonders in der regelmäßig wiederkehrenden Debatte um das Kreuz etwa sei eine gute Kommunikation wichtig. "Wir müssen versuchen, den Sinn des Kreuzes zu erklären - und nicht bei jeder befremdlichen Darstellung sofort die Keule Beleidigung schwingen", sagte der Bischof. "Das Kreuz Jesu ist doch der stärkste Ausdruck dafür, dass die Liebe letztlich stärker ist als alle Bosheit, stärker als Hass und Vergeltung. Aber der Anblick ist ein Hingerichteter auf einem Galgen. Das muss erst einmal erklärt werden. Und geglaubt."
An anderer Stelle in dem Gespräch erinnerte Glettler an die emotionale Debatte der 1980er Jahre um das vom Tiroler Bildhauer Rudi Wach gestaltete Kreuz auf der Innbrücke in Innsbruck. Das Kreuz mit einem Corpus ohne Lendenschurz wurde erst 2007 am vorgesehenen Ort aufgestellt. Die Nacktheit der Figur am Wach-Kreuz habe viel vordergründige Empörung ausgelöst, sagte der Bischof. Er selbst finde hingegen problematisch, dass der verklärte Gekreuzigte keine Wundmale hat. Wach habe ihm erklärt, dass er den reinen, strahlenden Christus darstellen wollte, berichtete Glettler. "Ich habe ihm entgegnet, dass dies eine Lüge sei. Der Auferstandene war kein Sunnyboy. Die Jünger erkannten ihn an den Wundmalen. Er ist durch den Tod hindurchgegangen - in vergebender Liebe."
"Da sind Gräben zu überwinden"
Glettler hat außer Theologie auch Kunstgeschichte studiert. Erst ist in der Österreichischen Bischofskonferenz für Kunst und Kultur zuständig und auch selbst als Künstler tätig. Allerdings verwende er für seine eigene Kunstarbeit nur "ganz, ganz wenig Zeit", wie er klarstellte. Wichtiger sei ihm das Vermitteln und der Aufbau von Vertrauen zwischen Kirche und Kulturschaffenden. "Da sind einige Gräben zu überwinden." Er sei Priester und wolle "vor allem die Frohbotschaft Jesu in die Sprache der Zeit bringen und sie mit möglichst vielen teilen", hob Glettler hervor. "Aber es stimmt auch, dass ich den Kunstvirus nicht mehr losbekomme. Vieles befruchtet sich zum Glück auch gegenseitig."
Auf Nachfrage äußerte sich Glettler auch über den Maler und Aktionisten Hermann Nitsch (1938-2022), den er bei dessen Tod im Vorjahr als "bleibende Inspirationsquelle" bezeichnet hatte. Er wolle Nitsch "sicher nicht heiligsprechen, auch nicht die Momente des Ekelhaften in seinem Werk übersehen", sagte der Bischof. Nitsch habe aber Vieles angeregt und seine Bedeutung habe in der Wiederentdeckung des sinnenfälligen Rituals gelegen. "Als in der katholischen Kirche die Liturgie entsinnlicht und zerredet wurde, hat er in der säkularen Kunstwelt sein Orgien-Mysterien-Theater entwickelt."
Eine Meldung von www.kathpress.at

Schönheit gibt es nicht billig
Tageszeitung: Herr Bischof Glettler, glauben Sie an Wunder?
Bischof Hermann Glettler: Ja, selbstverständlich. Sie geschehen täglich, meist im Verborgenen. Wenn in unserer nervösen Zeit Menschen geduldig miteinander umgehen, ist das doch ein Wunder, nicht wahr? Ohne Scherz, wirkliche Versöhnung ist ein Wunder. Da mischt sich Gott ein. Von den spektakulären Wundern halte ich wenig. Eigentlich genügt doch ein Grashalm, um ins Staunen zu kommen. Trotz allem: Das Leben ist schön! Der bekannte Film von Roberto Benigni ist ein Wunder von Menschlichkeit. Einfach schön!
Wenn Schönheit die Welt retten wird, wie Dostojewski schrieb, käme das einem Wunder gleich. Wann hat Schönheit in der blutrünstigen menschlichen Geschichte jemals jemanden gerettet?
Schönheit hat die Kraft uns aufzurichten, aus dem Sumpf von Banalität und Langeweile herauszureißen, aber sie ist kein magisches Tool zur Eindämmung menschlicher Grausamkeit. Leider nicht. Schönheit hat mit Lebenskultur zu tun und mit menschlicher Freiheit, das Gute zu wählen. Wir haben tatsächlich das Potential, eine humane Zivilisation aufzubauen oder dämonisch getrieben alles zu zerstören. Ethik und Ästhetik gehören zusammen. Schönheit ist jedenfalls weit mehr als nur eine Geschmacksfrage.
Erklären Sie uns bitte, wie und welche Schönheit die Welt retten soll und kann.
Bei Dostojewski ist die Schönheit, die die Welt retten wird, Christus selbst. Er ist die Liebe, die sich hingibt. Bei Benigni ist es der Vater, der seinen Sohn durch die Hölle des KZs durchträgt und sich aufopfert. Mit dem Blick auf Mutter Teresa ist mir diesbezüglich einiges klar geworden. Sie war äußerlich nicht schön, gekrümmte Gestalt, zerfurchtes Gesicht. Umwerfend schön war sie durch ihre radikal gelebte Nächstenliebe. Im Roman „Der Idiot“ ist es ein 17-jähriger Außenseiter, verkrüppelt und vom Tod gezeichnet, der die These von der Rettung der Welt durch Schönheit ins Spiel bringt. Das berührt mich.
Mit Rilkes „Duineser Elegien“ könnte man auf Dostojewski kontern: „Schönheit ist nichts als des Schrecklichen Anfang.“
Nein, das ist zu oberflächlich. Bei Rilke geht es doch darum, dass wirkliche Schönheit uns innerlich erschüttern kann. Wow! Großartig! Es fällt uns dann nichts Kluges mehr ein, wenn wir einfach von Schönheit überwältigt sind. Wer kennt denn nicht diese tiefen Momente, ob in der Natur oder in der Kunst? Die Aufführung der „Greek Passion“ bei den Salzburger Festspielen hat mich heuer in dieser Weise gepackt. Der Religionsphilosoph Rudolf Otte sprach übrigens vom „Mysterium tremendum et fascinosum“. Mit anderen Worten: Es gibt ein Geheimnis, das uns übersteigt. Oder übersetzt: Gott ist nicht zähmbar. Das Leben auch nicht.
Bei Platon führt das Bedürfnis nach Schönheit direkt zur Wahrheitsliebe. Haben Schönheit und Wahrheit für Sie etwas gemeinsam?
Ja, klar. Im Griechischen gibt es eine Entsprechung zwischen dem Adjektiv kalos, das „schön“ bedeutet, mit dem Verb kalein, übersetzt „rufen“. Das finde ich interessant. Schön ist das, was ruft, was einen Anspruch vermittelt. Schön ist das, was herausfordert. Schönheit gibt es jedenfalls nicht billig. Wahrheit auch nicht. Zumindest sollten wir, wie Václav Havel es ausgedrückt hat, „täglich versuchen, in der Wahrheit zu leben“. Wahrheit und Schönheit lassen sich auch nicht wie ein Konsumgut erwerben oder besitzen. Man kann sie nur bezeugen.
In der Kunst hat das Schöne spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts keinen guten Ruf mehr. Es steht unter dem Generalverdacht des Kitsches und der Beschönigung der Verhältnisse. Was ist für Sie Schönheit?
Schönheit hat für mich mit Intensität zu tun, mit Entsprechung und mit Ehrlichkeit gegenüber den vielen Wunden unserer Zeit. Auch die eigenen Verletzungen gehören dazu. Ich hatte mit dem Tiroler Künstler Rudolf Wach eine lange Debatte über den Gekreuzigten auf der Innbrücke. Sie wissen, wie viel vordergründige Empörung die Nacktheit dieser Figur ausgelöst hat. Ich finde etwas anderes problematisch: Der verklärte Gekreuzigte hat keine Wundmale. Wach erklärte mir, dass er den reinen, strahlenden Christus darstellen wollte. Ich habe ihm entgegnet, dass dies eine Lüge sei. Der Auferstandene war kein Sunnyboy. Die Jünger erkannten ihn an den Wundmalen. Er ist durch den Tod hindurchgegangen – in vergebender Liebe. Das ist seine faszinierende Schönheit!
Sie sind selbst Künstler. Welche Rolle spielt Schönheit in Ihrem künstlerischen Denken?
Im direkten Sinn keine. Im Gestaltungsprozess sind andere Kriterien für mich ausschlaggebend. Schönheit, die direkt angestrebt wird, endet meist im oberflächlichen Design – oder im Kitsch. Kitsch raubt die Möglichkeit zur eigenen Empfindung. Bezüglich meiner eigenen Kunstarbeit lassen Sie mich bitte klarstellen: Ich verwende dafür ganz, ganz wenig Zeit. Wichtiger ist mir das Vermitteln, der Aufbau von Vertrauen zwischen Kirche und den Kulturschaffenden unserer Zeit. Da sind einige Gräben zu überwinden.
Die Kirche war Jahrhunderte lang einer der wichtigsten Kulturträger, doch seit der Moderne liegen Religion und Kunst im Dauerkonflikt. Manche erkennen in dem Bruch der Kirche mit der zeitgenössischen Kunst den Kardinalfehler, weil sie sich damit von den entscheidenden kulturellen Entwicklungen abgekoppelt hat. Sehen Sie das auch so?
Grundsätzlich ja. Die Flucht in eine kirchliche Sonderwelt war fatal. Im geschlossenen kirchlichen Biotop ging die Lebendigkeit des Geistes verloren. Immer größer wurde die Angst vor der säkularen Wirklichkeit. Eine grundsätzliche Korrektur dieses defensiven Ansatzes hat erst das Zweite Vatikanische Konzil gebracht. Vertrauen auf den pfingstlichen Geist, Weltoffenheit und „Verheutigung“ waren die Signalworte des Aufbruchs in den 60er Jahren. Was nicht bedeutet, dass man zu jedem Zeitgeist Ja und Amen sagen muss.
Gelegentlich hat man den Eindruck, dass Kirche und Kunst nur noch über Skandale und Provokationen zusammenfinden. Liegt es am Personal der Kirche, dass das Vertrauen zwischen Kulturschaffenden und Kirche so grundsätzlich gestört ist?
Eine etwas breitere kulturelle Bildung würde uns allen sicher nicht schaden. Es gab im 20. Jahrhundert einige faszinierende Pioniergestalten, die einen erneuten Brückenschlag zur Kunst der Gegenwart versucht haben. Ich denke an den Dominikaner P. Alain-Marie Couturier, der während des Zweiten Weltkrieges von Amerika aus mit den wichtigsten Künstlern der französischen Moderne Kontakt aufgenommen hat. Danach konnte er Henry Matisse, Fernand Leger, Le Corbusier u.a. für kirchliche Aufträge gewinnen. In Österreich gab es einen Msgr. Otto Mauer, der mit prophetischer Klarsicht im Stephansdom gepredigt und in seiner Galerie „Nächst St. Stephan“ die wirkliche Avantgarde von damals ausgestellt hat. Noch viele andere wären zu nennen. Dass es mittlerweile in vielen deutschsprachigen Diözesen erstaunliche Kooperationen mit zeitgenössischen Kulturschaffenden gibt, verdankt sich deren Mut.
In Österreich nannte man Sie den Künstlerpfarrer. Wie schwierig war es, zwischen der Berufung zum Priester und Berufung zum Künstler zu entscheiden?
Für mich war es nie ein Problem. Ich habe für mich geklärt, was meine erste und eigentliche Berufung ist. Ich wusste schon als Jugendlicher, dass ich Priester werden möchte, weil ich dafür gebraucht werde. Ich möchte vor allem die Frohbotschaft Jesu in die Sprache der Zeit bringen und sie mit möglichst vielen teilen. Das ist aufregend und herausfordernd genug. Aber es stimmt auch, dass ich den Kunstvirus nicht mehr losbekomme. Vieles befruchtet sich zum Glück auch gegenseitig.
Mit dem Fastentuch des Künstlers Peter Garmusch auf dem Hochaltar der Spitalskirche, das ein Schweineherz zeigt, haben Sie in Innsbruck Proteste provoziert und es frühzeitig abgehängt. Wäre es nicht richtig gewesen, standzuhalten?
Die etwas vorzeitige Entfernung war ein Kompromiss. Ich wollte die Karwoche nicht mit einer überhitzten Kunstempörung stören. Viele Menschen haben leider nicht wirklich hingeschaut. Das großformatige Foto hat ein eingeschnürtes Herz gezeigt, das sensible Organ von einem Gummiring umschlossen. Ganz klare Bildsprache. Es ging im Kontext der Fastenzeit um Versöhnung, also um die Frage, wie eine Entlastung des Herzens möglich sein könnte. Nicht wenige wurden Opfer einer regelrechten Hetze gegen meine Kunstinitiative. Sie haben gemeint, dass mir die Tiroler Herz-Jesu-Frömmigkeit nichts wert sei. Das Gegenteil ist der Fall! Nicht zufällig habe ich im Herder-Verlag mit dem Titel „Dein Herz ist gefragt“ dazu ein Buch veröffentlicht. Ich möchte den Sinn einer jesuanischen Herz-Spiritualität möglichst vielen Menschen erschließen.
In einem Interview haben Sie gesagt, dass Sie die in Tirol so beliebten und verehrten Herz-Jesu-Bilder viel provokanter als viele zeitgenössische Werke finden. Was ist an einem Herz-Jesu-Bild provokant?
Wir haben uns zu sehr an die traditionellen Bilder gewöhnt. Ist es nicht irritierend, wenn uns Jesus sein zentrales Körperorgan mit der Hand entgegenstreckt? Und sind die blutende Stichwunde und die Dornenkrone rund um das Herz nicht auch gewöhnungsbedürftig? Wir sollten öfter genauer hinschauen, um die Kraft und Schönheit der alten kirchlichen Kunst wieder zu entdecken. Ja, da sind viele Wunden zu sehen, aber auch viel Lebensfreude, zumindest in der barocken Kirchenkunst nicht selten auch himmlische Ekstase.
Niemand war katholischer als der als Antichrist geschmähte Künstler Hermann Nitsch. Für Sie sei er jedoch eine „bleibende Inspirationsquelle“, haben Sie in Ihrem Nachruf auf Nitsch gesagt. Was inspiriert Sie an seiner Kunst?
Seine Bedeutung lag in der Wiederentdeckung des sinnenfälligen Rituals, auch des Kultischen. Als in der katholischen Kirche die Liturgie entsinnlicht und zerredet wurde, hat er in der säkularen Kunstwelt sein Orgien-Mysterien-Theater entwickelt. Ich will Nitsch sicher nicht heiligsprechen, auch nicht die Momente des Ekelhaften in seinem Werk übersehen. Warum er seine Schüttaktionen so unendlich oft wiederholt hat, war mir auch nicht mehr klar. Aber dennoch hat er Vieles angeregt. Der Wiener Aktionismus hätte ohne ihn wohl keine internationale Bedeutung erlangt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist Provokation ja nichts grundsätzlich Verwerfliches. Braucht es wieder mehr Provokation von Seiten der Kunst?
Provokation um ihrer selbst willen, ist unerträglich. Wenn jedoch qualitätsvolle Kunst provoziert, dann muss es wohl so sein. Zumindest müssen wir klären, wofür sich wirkliche Empörung lohnt. Wir leben in einer nervösen Zeit. Alte und neue Kunst kann Menschen aus der Zerstreuung sammeln und zutiefst berühren. Aus der digitalen Distraktion in die Wahrnehmung von Leben führen. Wenn wir zeitgenössischer Kunst in unseren Kirchen Gastfreundschaft gewähren, kann es zu einer vielfachen Inspiration kommen. Auch eine notwendige Solidarität mit den Verwundeten unserer Zeit kann durch Kunst
Der „beleidigte Gott“ und beleidigte religiöse Gefühle werden gerne auch politisch instrumentalisiert. Gibt es das überhaupt: religiöse Gefühle?
Ich denke schon. Aber wir sollten uns nicht zu schnell in die Ecke der Beleidigten treiben lassen. Besonders in der regelmäßig wiederkehrenden Debatte um das Kreuz ist eine gute Kommunikation wichtig. Wir müssen versuchen, den Sinn des Kreuzes zu erklären – und nicht bei jeder befremdlichen Darstellung sofort die Keule Beleidigung schwingen. Das Kreuz Jesu ist doch der stärkste Ausdruck dafür, dass die Liebe letztlich stärker ist als alle Bosheit, stärker als Hass und Vergeltung. Aber der Anblick ist ein Hingerichteter auf einem Galgen. Das muss erst einmal erklärt werden. Und geglaubt.
Eine Kunst, die der Kirche hilft, eine zeitgemäße Verkündigung des Evangeliums zu finden – wie könnte, sollte, müsste die aussehen?
Das ist eine gute Frage. Es gibt zum Glück einige Beispiele. Denken Sie an die Fresken von Max Weiler in der Innsbrucker Kirche auf der Hungerburg. Oder an die Arbeiten von Luis Fasching in Osttirol. Ich könnte hier vieles aufzählen. Zu allen Jahrhunderten war die Kunst einmal zeitgenössisch. Es ist ein permanenter Übersetzungsprozess. Die wichtigste Kulturarbeit der Kirche ist die Verkündigung des Evangeliums. Ich bin überzeugt, dass durch eine Beschäftigung mit der Kultur unserer Zeit dafür der nötige Boden bereitet werden kann – zumindest die Dialog- und Hörbereitschaft.