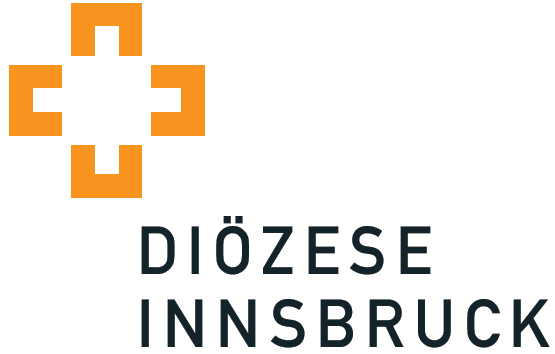Bischof Muser: Friedensprojekt Europa weiterschreiben
Den Erhalt einer "Seele" für Europa hat der Diözesanbischof von Bozen-Brixen, Ivo Muser, am Sonntagabend für Europa gefordert. Das "Friedensprojekt Europa" gelte es weiterzuschreiben, wofür ein "kräftiges Bindemittel" jenseits von nur politischen und wirtschaftlichen Vorteilen vonnöten sei. Dieser Kitt liege nicht in der "Restauration von Vergangenheit", vielmehr gelte: "Wir müssen lernen, miteinander zu leben, nicht nebeneinander", so der Südtiroler Oberhirte bei einer Vesperpredigt zum Auftakt der Festwoche zum 300-Jahr-Weihejubiläum des Innsbrucker Doms. Der Reichtum vieler verschiedener Kulturen auf heimatlichem Boden dürfe "nicht nivelliert werden, sondern er muss das vereinigte Europa prägen".
Muser kam auf den Begriff des "christlichen Abendlandes" zu sprechen, der wieder populär geworden sei. Er sei mit Vorsicht zu genießen, denn "nicht alles, was sich auf das Christentum beruft, ist auch vom Christentum geprägt", warnte der Bischof. Bedenken äußerte er, wenn heute vom christlichen Abendland "nur mehr als Abgrenzungs- und als ein Kampfbegriff gegen die anderen, wer immer sie auch sind", gesprochen werde.
Durchaus sei die Europäische Union auch als "christlich-humanistische Wertegemeinschaft" gegründet worden, mit überzeugten Katholiken als Gründervätern, so Muser weiter. Heute verliere der europäische Geist jedoch an Kraft und das große "Wir-Gefühl" zerfalle in "immer kleinere Wir". "Im Haus Europa sind die Bewohner dabei, sich wieder mehr in ihre eigenen vier Wände zurückzuziehen", stellte der Bischof fest. Im Zuge nationalistischer, fremdenfeindlicher, aggressiver, ausgrenzender und populistischer Tendenzen werde nach einem "gemeinsamen Feind, von dem wir uns schützen und abgrenzen müssen" gesucht, und "wir liebläugeln mit Grenzen".
Weder Vertröstung noch Weltflucht
Christliche Identität sei ganz anderer Natur, betonte Muser. Es handle sich dabei nicht um Wirklichkeitsverlust, Vertröstung oder Weltflucht, sondern um eine "Identität, die die eigenen Wurzeln kennt, liebt, pflegt, verteidigt und lebt - im offenen und konstruktiven Dialog mit der Identität der anderen". Statt zu trennen, sei das Christentum Quelle der Kraft und Hoffnung, um "gemeinsam Zukunft zu gestalten". Es ziele auf eine "Einheit in der Vielfalt" ab und lebe diese Einheit auch vor, um so "an einem gemeinsamen Europa zu bauen, wo verschiedene Sprachen und Kulturen sich auf heimatlichen Boden begegnen und gegenseitig bereichern".
Im Dialog mit der Identität des anderen gelte es, "unsere christliche Identität neu zu entdecken und zu pflegen", rief Bischof Muser auf. Christen fänden in ihren Kirchen Stille, Hören, Verweilen, Staunen, Besinnung, Gebet und Gesang, vor allem aber feierten sie hier in der Eucharistie den Tod und die Auferstehung Jesu- "um dann, von dieser Mitte her, ihren Beitrag zu leisten für die Gesellschaft, in der wir leben und für die wir auch Mitverantwortung übernehmen und tragen sollen". Leuchtende Beispiele dafür aus der jüngeren Tiroler Vergangenheit seien die NS-Märtyrer Josef Mayr-Nusser, Otto Neururer, Carl Lampert, Jakob Gapp, Franz Reinisch, Johann Schwingshackl und Johann Steinmayr gewesen, als "Christen durch und durch" in dunklen Zeiten.
Einst Filialkirche von Brixen
Bischof Muser erinnerte weiters daran, dass die Weihe des heutigen Doms am 9. September 1724 von seinem damaligen Vorgänger, Kaspar Ignaz von Künigl, vorgenommen worden war. Die St.-Jakobs-Kirche, ursprünglich Filialkirche des Brixener Doms, solle eine "Vorhalle des Himmels" werden, habe der Fürstbischof in einem Brief verfügt und auch, sein Herz möge vor dem von ihm gestifteten dortigen Hochaltar mit seinem Marienbild von Lukas Cranach bestattet werden - denn: "Hier habe ich Maria lieben gelernt". So sei es dann auch geschehen, während von Künigls Sarg in von ihm erbauten Bischofskirche in Brixen ruht.
Eine Meldung von www.kathpress.at

Die Predigt im Wortlaut
Lieber Bischof Hermann, liebe Festgemeinschaft, liebe Schwestern und Brüder im Glauben!
„Wir wollen nicht das Himmelreich – wir wollen das Erdenreich!“ – sagte polemisch Friedrich Nietzsche, ein intelligenter und leidenschaftlicher Kritiker des Christentums. Hier und jetzt soll unser Leben gelingen, hier und jetzt wollen wir glücklich sein. Und wenn Menschen dennoch die Hoffnung auf den Himmel hochhalten, dann ist das Wirklichkeitsverlust, unverantwortliche Vertröstung und Weltflucht.
Dieser barocke Dom von St. Jakob, der in dieser Woche zum Feiergrund wird, ist ein Ausrufezeichen und ein Kontrapunkt zu dieser Sicht auf das Leben. Christen glauben an die Brücke vom Himmel zur Erde und von der Erde zurück in den Himmel. Diese Brücke hat einen Namen: Jesus Christus. Er hat den Himmel „geerdet“: Nicht wir schaffen den „Himmel auf Erden“; wir können uns aber dem Himmel öffnen, der dort beginnt, wo wir IHN, auch vermittelt durch solche Räume, in unsere Welt einlassen.
Genau morgen vor 300 Jahren, am 9. September 1724, wurde diese Kirche ihrer Bestimmung übergeben. Die Weihe erfolgte durch meinen Vorgänger, Fürstbischof Kaspar Ignaz von Künigl. Mit seinen 45 Dienstjahren ist er der am längsten regierende Bischof der alten Diözese Brixen. Er war es auch, der den heutigen Brixner Dom erbauen ließ, auch wenn dessen Weihe erst in die Zeit seines Nachfolgers fiel. In einem Brief an das Brixner Domkapitel, der im Brixner Diözesanarchiv von ihm erhalten ist, sagt er, was seiner Überzeugung nach eine
Kirche sein sollte: eine „Vorhalle des Himmels“. Übrigens: Fürstbischof Künigl wurde im Brixner Dom begraben, aber sein Herz wurde auf seinen Wunsch hin hier in St. Jakob bestattet, vor dem prächtigen Hochaltar, den er gestiftet hat, vor dem weltberühmten Maria-Hilf- Bild von Lucas Cranach. Berührend finde ich die Begründung, die er selber für seinen Wunsch gegeben hat: „Hier habe ich Maria lieben gelernt“.
Dieser barocke Kirchenraum, der seit 300 Jahren eine „Vorhalle des Himmels“ sein will, um es mit den Worten des Weihebischofs zu sagen, kann uns heute Abend – und nicht nur heute Abend - zurufen: Mensch, vergiss und verdränge es nicht: Dein Leben hat Ewigkeitswert! Du bist nicht einfach in diese Welt hereingeworfen und zu diesem Leben verurteilt. Du brauchst mehr als das Vordergründige, das Funktionale, das Nützliche, das Materielle und das Ökonomische. Du brauchst mehr, weil du mehr bist!
Mensch, du darfst hoffen! Hoffen heißt Grenzen überschreiten, nicht im Hier und Jetzt aufgehen, nicht bei einer bloß menschlichen, innerweltlichen, in sich geschlossenen Perspektive stehen bleiben. Hoffnung hält den Horizont nach vorne offen. Der Schriftsteller und erste Präsident der Tschechischen Republik, Vaclav Havel, hat es so formuliert: „Hoffnung ist nicht Optimismus. Es ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“
Christlicher Glaube darf nicht Wirklichkeitsverlust, Vertröstung und Weltflucht sein. Er gehört nicht begrenzt auf die Sakristei und den Kirchenraum, er will Menschen in ihrer konkreten Lebenswelt Hoffnung schenken und das Zusammenleben der Menschen fördern. Christen und Christinnen versammeln sich in ihren Kirchen zur Stille, zum Hören, zum Verweilen, zum Staunen, zur Besinnung,
zum Gebet und zum Gesang, und vor allem zur Feier des Todes und der Auferstehung ihres Herrn in der Eucharistie, um dann, von dieser Mitte her, ihren Beitrag zu leisten für die Gesellschaft, in der wir leben und für die wir auch Mitverantwortung übernehmen und tragen sollen.
300 Jahre Kirchweihe St. Jakob. Nur mit einigen wenigen, keineswegs vollständigen, Stichworten will ich diese Jahrhunderte an uns vorüberziehen lassen. Diese Ereignisse haben entscheidend die weltliche und kirchliche Geschichte Tirols beeinflusst und geprägt. In diese drei Jahrhunderte fällt die Zeit Maria Theresias und ihres Sohnes Joseph II., die Französische Revolution, die Zeit Napoleons, die Tiroler Freiheitskämpfe rund um Andreas Hofer, das Herz Jesu Gelöbnis von 1796, das Erstarken des nationalistischen und rassistischen Gedankenguts im 19. Jahrhundert. Und dann ist es vor allem das 20. Jahrhundert mit seinen massiven und leidvollen Entwicklungen, die unsere Geschichte, diesseits und jenseits des Brenners, nachhaltig geprägt haben. Die Kriegsbegeisterung, die auch Tirol in den Jahren vor dem 1. Weltkrieg erfasst hat, der Zusammenbruch der Österreichisch – Ungarischen Monarchie, die dramatischen und grausamen Ereignisse des 1. Weltkrieges mit Millionen von Toten. An seinem Ende führt eine neue Staatsgrenze durch die alte Diözese Brixen, mit all den Konsequenzen, die sie auslösen wird. In Südtirol kommt es bald zur leidvollen Erfahrung des Faschismus, des Nationalsozialismus und der Option, die Familien und Gemeinschaften spaltet und gegeneinander aufbringt. Josef Mayr – Nusser ist eine unbequeme, leuchtende Persönlichkeit in dieser dunklen Zeit, ein Christ durch und durch. In Nordtirol kommt es auf dem Hintergrund der nationalsozialistischen Diktatur zu einer regelrechten Kirchenverfolgung. Otto Neururer, Carl Lampert, P. Jakob Gapp, P. Franz Reinisch, die beiden Jesuiten Johann Schwingshackl und Johann Steinmayr:
Ich nenne sie nur stellvertretend für ein anderes Tirol, inmitten einer menschenverachtenden und menschenvernichtenden Zeit, in der es auch diesseits und jenseits des Brenners viele Sympathisanten, Mitläufer und Täter gegeben hat. Die Verachtung und der millionenfache Mord an den Juden im Dritten Reich hat auch vor Tirol nicht Halt gemacht. Auch die Entfremdung zwischen dem Norden und dem Süden Tirols, vor allem nach dem 2. Weltkrieg, darf nicht verschwiegen werden. Das wichtigste, kirchliche Ereignis in der Geschichte Tirols ist dann 1964: Vor genau 60 Jahren kommt es zur Neuumschreibung der Diözese Brixen, jetzt als Bozen – Brixen, und zur Errichtung der neuen und selbstständigen Diözese Innsbruck.
Auf dem Hintergrund dieser wechselvollen Geschichte mit ihren Licht- und Schattenseiten, mit ihren Wunden, ihren Aufbrüchen und auch mit ihrem Versagen, lege ich uns allen an diesem Abend ein Anliegen ans Herz, das uns verbinden kann und das uns hilft, die Geschichte gemeinsam weiterzuschreiben: das Friedensprojekt Europa. Mir geht es dabei um eine Hoffnung und um einen Einsatz, die sich orientieren am christlichen Glauben.
Europa braucht eine Seele. Ohne ein kräftiges Bindemittel hat das „Projekt Europa“ bei allen Vorteilen, die es politisch und wirtschaftlich bietet, keine Zukunft. Dabei kann der Kitt nicht einfach in der Restauration von Vergangenheit liegen. Wir müssen lernen miteinander zu leben, nicht nebeneinander. Wir haben in Europa so viele verschiedene Kulturen auf heimatlichem Boden. Dieser Reichtum darf nicht nivelliert werden; er muss das vereinigte Europa prägen.
Der Begriff des „christlichen Abendlandes“ ist wieder populär geworden. Nur: Nicht alles, was sich auf das Christentum beruft, ist auch vom Christentum geprägt. Nicht selten wird heute das „christliche Abendland“ nur
mehr als ein Abgrenzungs- und als ein Kampfbegriff verwendet - gegen die anderen, wer immer sie auch sind.
Die Europäische Union ist nach den dramatischen Erfahrungen der Diktaturen und des 2. Weltkriegs gegründet worden, durchaus auch als christlich –humanistische Wertegemeinschaft. Robert Schumann, Konrad Adenauer und Alcide de Gasperi, die bekanntesten Gründerväter eines geeinten Europas, waren überzeugte Katholiken. Der europäische Geist verliert heute aber an Kraft. Das Wir-Gefühl bröckelt. Das große Wir zerfällt in immer kleinere Wir. Im Haus Europa sind die Bewohner dabei, sich wieder mehr in ihre eigenen vier Wände zurück zu ziehen. „Vorsicht vor diesem Wir“ – kann man immer häufiger hören! Nationalistische, fremdenfeindliche, aggressive, ausgrenzende und populistische Töne werden wieder salonfähig – immer auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, von dem wir uns schützen und abgrenzen müssen.
Die vielen neuen Wir liebäugeln mit Grenzen. Manchmal habe ich den Eindruck: Jede Gelegenheit ist dafür recht. Der kühne Gedanke der ersten Christen war ein anderer. Paulus hat entscheidend dazu beigetragen, das Christentum nach Europa zu bringen. Von ihm stammt die Aussage: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus“ (Gal 3,28). Über sich selber schreibt der Völkerapostel: Er sei den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche geworden (vgl. 1 Kor). Das ist christliche Identität! Eine Identität, die die eigenen Wurzeln kennt, liebt, pflegt, verteidigt und lebt – im offenen und konstruktiven Dialog mit der Identität der anderen. Das ist das christliche Ringen, um Europa eine Seele zu geben.
Er träume von einem inklusiven Kontinent, sagte Papst Franziskus in seiner Dankesansprache anlässlich der
Verleihung des Karlspreises 2016. Damit wendet er sich gegen die Versuche, die Menschen mit Hilfe der Religion gegeneinander aufzubringen. Christen und Christinnen haben die Aufgabe, aus der Kraft des Evangeliums Zukunft zu gestalten, Zeugnis der Hoffnung in der Gesellschaft abzulegen.
Er träumt, so der Papst weiter, von einer neuen europäischen Humanität. Damit diese Wirklichkeit werden kann, braucht es Gedächtnis, Mut und eine gesunde menschliche Zukunftsvision. Papst Franziskus zitiert dabei den jüdischen Schriftsteller Elie Wiesel, einen Überlebenden des Holocaust, der von einer „Transfusion des Gedächtnisses“ sprach. Erinnerung heißt Befreiung von den alten Feindbildern und von den Methoden sie aufzubauen und zu rechtfertigen. Erinnerung bedeutet auch, den politischen Willen aufbringen, der aus alten Feinden Partner und Freunde macht.
In seiner Botschaft an das „Forum Alpbach“ schrieb der Papst vor wenigen Tagen die bedenkenswerten Worte: „Wir leben momentan in einer Zeit der Krise in Europa, die wie jede Krise Gefahren und Chancen mit sich bringt; in einer Zeit, in der sich verschiedene populistische Bewegungen großer Beliebtheit erfreuen. Die Gründe dafür liegen vor allem in ökonomischen und politischen Faktoren. Wir sehen also, dass in Europa infolge dieser populistischen „Welle" einige Ideale verblasst und manche Prinzipien hinsichtlich des Umgangs mit den Schwächsten unserer Gesellschaft in den Hintergrund getreten sind.“
Mögen wir als Menschen der Hoffnung und der Transzendenz unser Leben gestalten; möge es uns geschenkt sein, Einheit in der Vielfalt zu wollen und zu leben; mögen wir an einem gemeinsamen Europa bauen, wo verschiedene Sprachen und Kulturen sich auf heimatlichen Boden begegnen und gegenseitig
bereichern; mögen wir unsere christliche Identität neu entdecken und pflegen im respektvollen Dialog mit der Identität der anderen; und möge unser Zusammenleben, diesseits und jenseits des Brenners, geprägt sein vom festen Willen, aus der großen, aber auch leidvollen Geschichte Tirols und unseres Kontinents zu lernen.
Liebe Festgemeinschaft, der Dom St. Jakob ist mir sehr vertraut seit meiner Studienzeit im Canisianum und an der Theologischen Fakultät hier in Innsbruck. In diesen fünf Jahren zwischen 1981 und 1986 habe ich oft diesen Dom besucht. Und ich gestehe es gerne: vor allem wegen des Maria-Hilf- Bildes von Lucas Cranach. Heute, am Abend des Festes Mariä Geburt und am Vorabend des 300jährigen Weihetages dieses Doms, stelle ich mich in Dankbarkeit und Hoffnung wieder vor dieses Bild. Mein Gebet für unsere beiden Diözesen Innsbruck und Bozen – Brixen und für unser Land Tirol diesseits und jenseits des Brenners, für Österreich und für Italien, für Europa und für die Welt, verbindet sich mit den Worten des schönen Marienliedes, das hier in Innsbruck entstanden ist und das eng verbunden ist mit dem Gnadenbild dieses Domes: „Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus. Lass uns darunter sicher stehn, bis alle Stürm vorübergehn… Patronin voller Güte, uns allezeit behüte.“