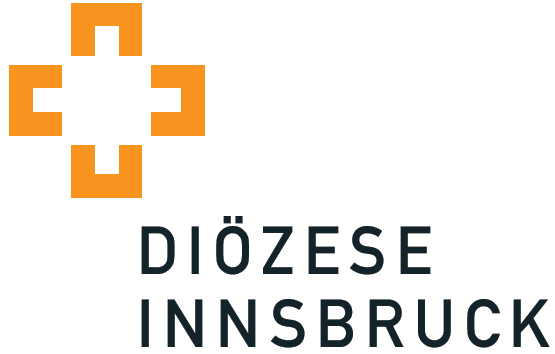Vor 1.700 Jahren ging das Konzil von Nicäa zu Ende
Knapp zwei Monate lang hatten Bischöfe und Theologen teils erbittert gestritten, Vorschläge ausgefeilt, Bündnisse geschmiedet. Der Kaiser als Gastgeber hörte geduldig zu und setzte am Ende - wohl mit etwas Druck - einen Kompromiss durch. Vor 1.700 Jahren, am 25. Juli 325, ging das Konzil von Nicäa (Nizäa) zu Ende, das einen Streit um den Ostertermin und eine Reihe von Detailfragen zur Kirchendisziplin entschied. Vor allem aber verurteilte es die weit verbreitete Auffassung, Jesus Christus sei zwar Gottes Sohn, dem Vater aber untergeordnet. Im verabschiedeten Glaubensbekenntnis heißt es: "Wir glauben ... an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist ... gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater ...".
Wie kam es dazu? Wenige Jahre zuvor waren die Christen noch grausam verfolgt worden. 313 gewährte ihnen Kaiser Konstantin Religionsfreiheit. Aus der jüdischen Sekte rund um den galiläischen Wanderprediger Jesus von Nazareth war eine etwa drei Millionen Männer, Frauen und Kinder umfassende Glaubensgemeinschaft geworden. Deren Einsatz für Arme und Schwache sowie ihr heldenhafter Mut angesichts ihrer Henker beeindruckten viele.
Gestärkt durch Widerstand im Untergrund und beflügelt durch ihren Glauben und den Zulauf vieler Menschen, entwickelten vor allem ihre Bischöfe großes Selbstbewusstsein. Der Kaiser, seit wenigen Monaten erst Alleinherrscher, musste das vom Zerfall bedrohte Reich zusammenhalten. Dabei kam ihm die zunehmende Verbreitung des Christentums recht, dessen innere Konflikte hingegen nicht.
So stritten etwa ab 320 im östlichen Reich der Priester Arius und sein Bischof Alexander darüber, in welchem Verhältnis Jesus Christus zu Gott Vater steht. Das war keine rein intellektuelle Debatte: Kirchenführer und Gemeinden kämpften gegeneinander. Konstantin musste eingreifen. Er nutzte eine geplante Bischofssynode in Ankyra, dem heutigen Ankara, und verlegte diese in das nahe seiner Sommerresidenz gelegene Nicäa, heute Iznik. Es lag südöstlich der neuen Reichshauptstadt Konstantinopel, dem heutigen Istanbul.
Anwesend in Nicäa waren gut 200 Bischöfe plus zahlreiche weitere Theologen. Unter ihnen auch ein gewisser Bischof Nikolaus von Myra, der später zu einem der beliebtesten Heiligen der Christenheit werden sollte.
Zum Osterdatum legte das Konzil fest: Das wichtigste Fest der Christen ist immer und überall am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond und nach Abschluss des jüdischen Pessach zu feiern. Den genauen Termin auszurechnen überließ man dem Bischof von Alexandrien, der die besten Astronomen hatte.
Über das Verhältnis von Gott/Vater und Sohn stritt das Konzil erbittert. Der Schlüsselbegriff, mit dem die Auffassung, Jesus Christus sei Gottvater untergeordnet, abgewehrt werden sollte, war der griechische Ausdruck "homoousios" ("wesensgleich"). Der wird im heutigen liturgischen Text übersetzt mit: "eines Wesens mit dem Vater". Der Ausdruck war umstritten, weil er nicht in der Bibel vorkommt. Konstantin aber wollte Einigkeit und setzte das "homoousios" durch.
Ein Konzilsteilnehmer, Eusebius von Cäsarea (260/64-339), schrieb damals, die Aussagen über Gott und Jesus Christus hätten eine "geistliche und unaussprechliche Bedeutung". Anders als manche Theologen es gerne gehabt hätten, wollten weder das Konzil von Nicäa noch spätere Kirchenversammlungen genau definieren, wie Gott zu verstehen sei. Vielmehr ging es um Formulierungen, die sein Geheimnis umschreiben, teils in der Schwebe halten und Irrlehren abwehren.
Stark vereinfachend formulierte der Theologe Joseph Ratzinger und später Papst Benedikt XVI. (1927-2022) einmal, das Dogma vom wesensgleichen Sohn "überträgt einfach das Faktum (und die Art) des Betens Jesu in philosophisch-theologische Fachsprache, nichts sonst". Der in Berlin lehrende Jesuit Felix Körner deutete die Wesensgleichheit so: "Christusgemeinschaft ist (...) volle Gemeinschaft mit Gott." Damit war aber auch der theologisch radikale Bruch zum Judentum markiert - und zum Islam, der 300 Jahre später entstehen sollte.
Das Bekenntnis von Nicäa diente zunächst dazu, die Lehre des Arius abzuwehren. Im Gottesdienst durchsetzen konnte es sich noch nicht. Vielmehr gingen die Kontroversen zwischen Anhängern des Arius und dessen Gegnern weiter. Erst 381 beim Konzil von Konstantinopel wurde das Bekenntnis erweitert und von nahezu allen christlichen Kirchen übernommen: das Nizäno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, im Westen oft das Große Credo genannt.
Die Auffassung des Arius, dass Jesus Christus Gott Vater untergeordnet sei, dürfte heutigen Zeitgenossen nicht fremd sein. Ist er doch für viele eher ein vorbildhafter, prophetischer Mensch - aber Gott ...? Zuletzt mahnten Theologen verschiedener Konfessionen, die anders lautende Lehre des Konzils von Nicäa nicht zu vergessen. Hat diese doch auch eine weitergehende soziale Komponente.
Der christliche Glaube, dass Gott in Jesus vollständig Mensch wurde, sowie Jesu Gebot, den Nächsten ebenso zu lieben wie Gott, wurde für Christen ein zusätzlicher Impuls, sich sozial zu engagieren. Der Priester Ivan Illich (1926-2002) etwa war überzeugt, dass Gottes Menschwerdung "ein überraschendes und gänzlich neues Erblühen von Liebe und Erkenntnis möglich macht". Christen könnten Gott im konkreten Menschen ihnen gegenüber lieben. So haben laut einer Studie der Universität Münster aus dem Jahr 2014 christliche Religionsgemeinschaften die Entstehung europäischer Wohlfahrtsstaaten weit mehr beeinflusst als bis dahin bekannt.
So sehr die Kirchen das Konzil von Nicäa beschwören - eine zentrale ökumenische Feier zum Jubiläum kam bisher nicht zustande. Die altorientalischen Kirchen trafen sich im Mai einige Tage in Kairo beim koptischen Patriarchen Tawadros II. Der Weltkirchenrat veröffentlichte eine Erklärung. Das Ehrenoberhaupt der Orthodoxen, Patriarch Bartholomaios I., würdigte das Jubiläum in einer Enzyklika. Und im November wird wahrscheinlich der römisch-katholische Papst Leo XIV. Bartholomaios in Istanbul besuchen und des Konzils gedenken.
Eine Meldung von www.kathpress.at