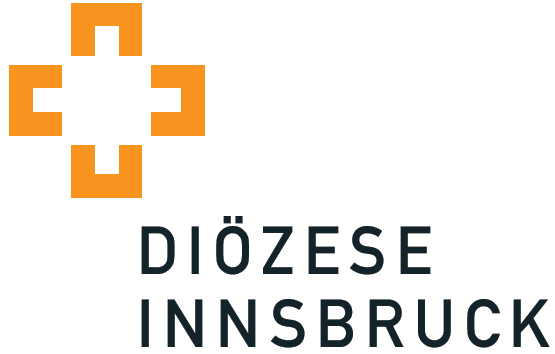Reichenau: Ort des Gedenkens am Jahrestag
Der Zweite Weltkrieg endete in Europa am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation des NS-Staates. 80 Jahre danach beginnt die Umsetzung des Gedenkorts Reichenau für alle Opfer des Lagerkomplexes Reichenau. Mit einem gemeinsamen Festakt von Land Tirol und Stadt Innsbruck wurde der Baubeginn begangen – und die ersten Prototypen von 114 derzeit geplanten „Namenssteinen“ enthüllt. Bischof Hermann Glettler nahm am Spatenstich teil.
„Eine lebendige Erinnerungskultur wird durch sichtbare und erlebbare Gedenkstätten geprägt. Mit der Enthüllung des ersten Namenssteins am Gedenkort Reichenau setzen wir heute ein weiteres bedeutendes Kapitel zeitgemäßer Erinnerungskultur. Dies geschieht in Anerkennung und Gedenken an die Schicksale der Opfer, stets im Bewusstsein, dass Geschichte sich nicht wiederholen darf. Mein Dank gilt allen Beteiligten dieses Projekts. Es ist ein kraftvolles gemeinsames Zeichen gegen das Vergessen und ein Engagement für die Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit – im Interesse einer besseren Zukunft“, sagt Tirols Landeshauptmann Anton Mattle.
„80 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur schaffen wir einen neuen Ort des Gedenkens – und widmen ihn allen Menschen, die im Lagerkomplex Reichenau und darüber hinaus ermordet wurden. Hier und an vielen anderen Orten in Österreich wurden Verbrechen begangen, die sich gegen zahlreiche Menschen richteten – und ihnen die Menschlichkeit und das Leben nahmen. Mit dem Gedenkort Reichenau geben wir den Opfern ihre Menschlichkeit zurück – Namensstein für Namensstein. Aus den anonymen Nummern, auf die Menschen damals reduziert wurden, werden wieder Vor- und Nachnamen, Aktennotizen wieder zu Biografien, und der ehemalige Standort des Lagerkomplexes zu einem Denkmal für alle Menschen, die hier gelitten haben und ermordet wurden“, betont Bürgermeister Ing. Mag. Johannes Anzengruber, BSc.
„Wir gedenken heute und für alle Zeit der Menschen, die hier inhaftiert, gefoltert und ermordet wurden. Der Gedenkort Reichenau wird ihnen ein würdiges Andenken sein. Durch die Verbindung von analogen und digitalen Inhalten, der Vergangenheit mit der Gegenwart, an einem Ort, der den Menschen gewidmet ist, gehen wir heute einen neuen Weg in der Erinnerungsarbeit. Wie macht man das Unbegreifliche greifbar? Wie kann man das Unfassbare fassen? Wie kann bleibendes Gedenken in der heutigen Zeit und darüber hinaus funktionieren? Wie geben wir Menschen, denen alles genommen wurde, ihre Namen und Biografien zurück? Mit dem Gedenkort Reichenau bauen wir eine mögliche Antwort auf diese Fragen. Vielen Dank an alle, die daran mitwirken!“, gibt Vizebürgermeister Georg Willi mit auf den Weg.
„Wir freuen uns, den Gedenkort Reichenau gemeinsam mit unseren Projektpartnerinnen und –partnern zu realisieren. Wichtige Grundlage dafür ist die neuere Forschung zum Lagerkomplex Reichenau, die ab dem Jahr 2022 betrieben wurde. Auf dieser Basis konnten wir die Errichtung eines neuen, zeitgemäßen Denkmals für die Opfer des Lagerkomplexes vorantreiben. Mit der Umsetzung durch die Werkgemeinschaft beginnt ein neues Zeitalter in der Innsbrucker Gedenkkultur“, so Kulturamtsvorständin Isabelle Brandauer.

Der „Gedenkort Reichenau“ entsteht in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Lagerkomplexes: Direkt am Innufer östlich der Grenobler Brücke wird ein offener Pavillon mit einer Dachskulptur zu finden sein, der den Beginn des Denkmals markiert und Raum zur Reflexion gibt. Darin finden sich Informationen zum Lagerkomplex Reichenau, bestehend aus dem „Arbeitserziehungslager“, in dem zwischen 1941 und 1944 rund 8.500 bis 8.600 Menschen, und dem „Lager Nord“, in dem rund 700 Menschen inhaftiert wurden.
„Durch die neue, historische Aufarbeitung der Geschichte des Lagerkomplexes liegen erstmals die Namen und biografischen Daten von 114 ermordeten Menschen vor. Beschäftigt man sich mit ihren Biografien, merkt man schnell, wie vielfältig die Lebensgeschichten waren, die hier beendet wurden. Bislang sind Opfer aus 15 Ländern bekannt, hauptsächlich Männer, aber auch zwei Frauen, die die NS-Diktatur im Lager Reichenau ermordet hat – und wir hören nicht auf, bis wir allen ihre Namen zurückgeben können“, erklärt DDr. Lukas Morscher, Leiter des Innsbrucker Stadtarchivs.
Entlang von Zeitstrahlen am Boden – die die Monate, in denen das Lager bestand, markieren – werden entsprechend des Todesdatums der Opfer „Namenssteine“ errichtet, die aus Beton und Glasterrazzo gegossen werden und die Namen aller an diesem Ort ermordeten Menschen tragen, auch ihr Herkunftsland und Alter sind darauf zu finden. Zusätzlich zu den Namenssteinen für die derzeit 114 bekannten Opfer sind weitere Namenssteine geplant, falls durch historische Forschung weitere Namen bekannt werden. Weitere Bodenelemente, die sich zu einer Welle erheben, verdeutlichen die Anzahl der Menschen, die im Lagerkomplex Reichenau inhaftiert wurden.
Begleitend zum physischen Gedenkort wirkt ein didaktisches Zusammenspiel aus analogen und digitalen Wegen des Gedenkens: Ein eigener Audioweg, der zusätzlich abgerufen werden kann, begleitet BesucherInnen des Gedenkorts und liefert weitere Fakten zum Lagerkomplex Reichenau und der darin inhaftierten Menschen, per Displays werden Inhalte visuell aufbereitet. Ein weiteres Herzstück des Gedenkprojekts ist das digitale Archiv zum Lagerkomplex, das über eine zugehörige Website öffentlich zugänglich sein wird.
Der Gedenkort Reichenau wurde von der Arbeitsgemeinschaft Heike Bablick–Ricarda Denzer– Karl-Heinz Machat–Bettina Schlorhaufer–Hermann Zschiegner entworfen, die sich in einem internationalen Gestaltungswettbewerb durchsetzen konnte. Die Umsetzung erfolgt mit der Werkgemeinschaft Heike Bablick–Ricarda Denzer–Karl-Heinz Machat–Hermann Zschiegner.
„Sichtbarste Elemente des neuen Gedenkorts Reichenau sind die individuell gestalteten Namenssteine, die an die 114 Toten des ‚Arbeitserziehungslagers‘ erinnern. Ihre Anordnung auf dem langgestreckten, leicht gewellten Gelände richtet sich nach dem Zeitpunkt ihres Todes. Bodensteine erinnern an die insgesamt über 8.500 Häftlinge des Lagers. Ein Hörweg dient der poetischen und erzählerischen Wissensvermittlung, eine Website der schriftlichen und bildlichen. Ein Archiv der Erinnerungsfragmente wird integraler Bestandteil davon sein. Der Pavillon, der in der zweiten Projektphase entstehen wird, stellt eine Verbindung zwischen dem Gedenkort selbst, dem Hörweg, der Landschaft und dem virtuellen Angebot der Website her“, führt die Werkgemeinschaft Heike Bablick–Ricarda Denzer–Karl-Heinz Machat–Hermann Zschiegner zum Projekt aus.

Bürgermeister Johannes Anzengruber: „Hier und an vielen anderen Orten in Österreich wurden Verbrechen begangen, die sich gegen zahlreiche Menschen richteten – und ihnen die Menschlichkeit und das Leben nahmen.“

Landeshauptmann Anton Mattle: „Eine lebendige Erinnerungskultur wird durch sichtbare und erlebbare Gedenkstätten geprägt.
Im Gedenkakt am 8. Mai 2025 wurden die ersten Prototypen der Namenssteine enthüllt. Zwei davon sind stellvertretend allen Opfern des Lagerkomplexes Reichenau gewidmet. Der erste Prototyp, der einer Einzelperson gewidmet ist, ist für Jakob Justman, der im Alter von 49 Jahren ermordet wurde.
Die jüdische Familie Justman stammt ursprünglich aus Polen: Jakob Justman flüchtete gemeinsam mit seiner Tocher Leokadia Justman aus den Ghettos von Warschau und Piotrków, seine Frau Sofia Justman wurde im Vernichtungslager Treblinka ermordet. Jakob und Leokadia Justman fanden zuerst in Seefeld, dann in Innsbruck unter falscher Identität Unterkunft und Arbeit. Nach einem Verrat wurden beide von der Gestapo verhaftet. Jakob Justman wurde am 24. April 1944 im Lager Reichenau ermordet. Sein Grab ist heute im jüdischen Teil des Innsbrucker Westfriedhofs zu finden.
Jakob Justmans Tochter Leokadia gelang gemeinsam mit ihrer Freundin Marysia Fuchs die spektakuläre Flucht aus dem NS-Polizeigefängnis am Innsbrucker Hauptbahnhof. Leokadia Justmans Flucht- und Lebensgeschichte wurde durch ein Team um die beiden Historiker Niko Hofinger (Stadtarchiv Innsbruck) und Prof. Dr. Dominik Markl SJ (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) aufgearbeitet und im kürzlich erschienen Buch „Brechen wir aus! Als polnische Jüdin auf der Flucht in Tirol“ präsentiert, bis 26. Oktober 2025 ist dazu eine Sonderausstellung im Tiroler Landhaus zu sehen. Alle Informationen dazu finden sich unter: www.tirol.gv.at/erinnern
„Leokadia Justmans Erinnerungen gewähren uns einen einzigartigen Einblick in die dramatische Geschichte ihrer Rettung, aufgrund derer fünf Polizisten und drei Frauen, die ihr in Innsbruck geholfen haben, von der Jerusalemer Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem als ‚Gerechte unter den Völkern‘ anerkannt wurden. Zugleich zeigt diese Geschichte, mit welcher Brutalität Menschen wie Leokadias Vater Jakob Justman und der ebenfalls aus Polen stammende Jude Dawid Janaszewicz in Innsbruck ermordet wurden. Auch Leokadias späterer Ehemann Józef Wiśnicki war in den letzten Kriegswochen im Lager Reichenau inhaftiert – er hat zum Glück trotz Unterernährung überlebt“, erklären die Historiker Niko Hofinger und Dominik Markl zur Enthüllung des Namenssteins für Jakob Justman.

(v.l.n.r.) P. Dominik Markl SJ, Rebecca Wisnicki, Jeffrey Wisnicki und Vizebürgermeister Georg Willi am Grab von Jakob Justman am Innsbrucker Westfriedhof.
Projektphase 1 beinhaltet die Landschaftsgestaltung mit gepflasterten Oberflächen und Namenssteinen, den Audioweg, die analoge Informationstafel vor Ort, sowie das per Website zugängliche digitale Archiv. Der Abschluss von Projektphase 1 ist für 2026 geplant.
In Projektphase 2, die für das Jahr 2026 geplant ist, fällt die Errichtung des Pavillons, die Montage der vorgesehenen Displays für historische und didaktische Informationen, Sitzgelegenheiten und Beleuchtung sowie die Dachskulptur des Pavillons samt Witterungsschutz. Die geschätzten Bruttogesamtkosten für die Errichtung des Gedenkorts Reichenau im Vollausbau (Projektphase 1 und 2) belaufen sich auf rund 1.278.000 Euro, von denen 840.000 Euro von der Stadt Innsbruck getragen werden. Die Differenz zum Gesamtbetrag für den Ausbau wird vollständig durch externe Fördergelder bereitgestellt, das Land Tirol und weitere PartnerInnen sind an der Finanzierung beteiligt.
Informationen und Veranstaltungen
Das Projekt wird auch in der Umsetzung auf vielfältige Weisen begleitet: Am 14. Mai 2025 beginnt die Veranstaltungsreihe „Fokus Reichenau“, bei der die Stadt Innsbruck in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Einblicke in die Geschichte des Lagerkomplexes bietet und aktuelle Fragen der Erinnerungskultur anspricht. Die erste Veranstaltung zum Thema „KZ-Gedenkstätten im Umbruch“ findet am Mittwoch, den 14. Mai von 19.00 bis 21.00 Uhr im Plenarsaal des Innsbrucker Rathauses statt. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Website der LFU Innsbruck.
Zusätzlich finden sich weitere Hintergrundinformationen zum Lagerkomplex und Gedenkort Reichenau in der aktuellen Podcast-Reihe des Innsbrucker Stadtarchivs unter: www.innsbruck.gv.at/podcasts
Interessierte sind eingeladen, als PatInnen mit ihrer Stimme an den Namen eines der 114 Menschen zu erinnern. Mit dieser Patenschaft tragen sie zum Hörweg als Teil der Erinnerungsarbeit der Gedenkstätte bei. Weitere Informationen per Mail an: patenschaft@gedenkort-reichenau.at

Der Chor der Musikmittelschule sorgte für musikalische Begleitung.

Am 8. Mai fand der Festakt zur Umsetzung des Gedenkortes Reichenau am künftigen Standort der Gedenkstätte statt.