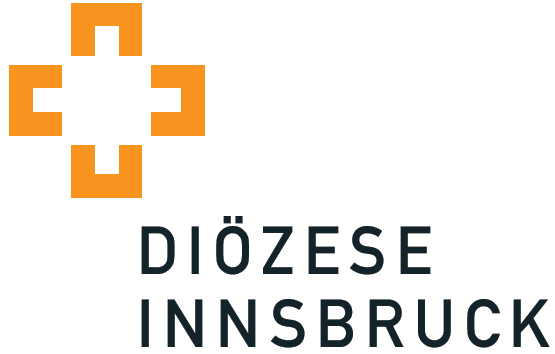Positionspapier 2025 der KA Innsbruck
Gesellschaftspolitischer Arbeitskreis der Katholischen Aktion der Diözese Innsbruck (Teil 1: Juli 2025, Teil 2: November 2025, Teil 3: 2026)
Teil 1: Dringende Maßnahmen für Kinder und Jugendliche
Wir begrüßen die Absicht der Bundesregierung, die Kinderarmut in Österreich bis 2030 zu halbieren (Regierungsprogramm Seite 114, Kinderarmut). Wir erwarten, dass im darauffolgenden Jahrzehnt Kinderarmut beseitigt wird. Viele der dazu notwendigen Maßnahmen erfordern eine Vorlaufzeit von mehreren Jahren (zum Beispiel für die Ausbildung von qualifiziertem Personal, für bauliche Maßnahmen, für strukturelle Reformen, …). Daher ist es notwendig, dass entsprechende Planungen sofort beginnen und eventuell notwendige Beschlüsse im Parlament rasch gefasst werden.
Der Wohlstand unseres Staates beruht auf dem Generationenvertrag: Die erwerbstätige Generation zahlt sowohl die Pensionen der Alten als auch Unterhalt und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen. Damit wird einerseits abgegolten, was die erwerbstätige Generation in ihrer Kindheit und Jugend erhalten hat, andererseits ein Anspruch auf Versorgung im Alter begründet. Für das Funktionieren des Generationenvertrags, insbesondere zur Vermeidung von Altersarmut, muss immer wieder eine nächste Generation heranwachsen, die leistungsfähig ist und solidarisch denkt, das heißt: fähig und willens ist, ihrerseits die Menschen zu erhalten, die noch nicht oder nicht mehr erwerbstätig sind.
Leistungen für den Unterhalt, die Bildung und die Förderung von Kindern und Jugendlichen sind daher keine Almosen, sondern für die Gesellschaft überlebenswichtige Investitionen in die Zukunft.
• Wir unterstützen besonders das Vorhaben, in allen Bildungseinrichtungen „kostenlose gesunde Mahlzeiten“ (Regierungsprogramm Seite 114, Kinderarmut) anzubieten.
Durch Einbindung der Schulen und Gemeinden (Ideenwettbewerbe?) könnten innovative und kostengünstige Lösungen gefunden werden. Zum Beispiel könnten Schüler:innen in die Erstellung des Speisenplans und die Zubereitung des Essens in der Schule eingebunden werden. Das fördert den sozialen Zusammenhalt der Schüler:innen und vermittelt ihnen für das Alltagsleben wichtige Kenntnisse.
• Zur Förderung der Gesundheit der Kinder und Jugendlichen braucht es ausreichend viele schulische Angebote für Bewegung. Zur Unterstützung der Lehrpersonen bei gesundheitlichen, sozialen und psychologischen Fragen sollten qualifizierte Ansprechpersonen zur Verfügung stehen.
• Die Veränderungen in den Familienstrukturen während der vergangenen Jahrzehnte haben dazu geführt, dass viele Kinder am Nachmittag alleine sind. Das macht Angebote für Nachmittagsbetreuung notwendig (Regierungsprogramm Seite 208, Ausbau der Ganztagsschulen, Gemeinsame Schule).
• Nach wie vor ist der Anteil der Jugendlichen, die nach Abschluss der Pflichtschule nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können, um im Berufsleben erfolgreich zu sein, in Österreich überdurchschnittlich hoch. Einer der Gründe dafür liegt in der Trennung der Schulen der Sekundarstufe 1 in Mittelschule und Gymnasium. Es ist höchste Zeit, das zu ändern. Das Parlament sollte bald den Grundsatzbeschluss fassen, in spätestens 10 Jahren die gemeinsame Schule für alle Kinder (bis 14 Jahren) einzuführen (Regierungsprogramm Seite 209, Ausbau der Ganztagsschulen, Gemeinsame Schule). Eine wichtige Vorarbeit dafür wurde schon geleistet: die einheitliche Ausbildung aller Lehrpersonen für alle Schulen der Sekundarstufe. Dann kann ein flächendeckendes Angebot mit Schulen der Sekundarstufe 1 entstehen, das allen Kindern einen relativ kurzen Schulweg bietet. Auch der Unterricht in der Volksschule würde nicht mehr von der bevorstehenden Selektion überschattet sein. Die Aufteilung in Landes- und Bundeskompetenzen im Bereich der Sekundarstufe 1 ist sachlich nicht begründbar und macht das System unflexibel.
• Die Transferleistungen für Kinder und Jugendliche (Säule 2 der Kindergrundsicherung; Regierungsprogramm Seite 113, Kinderarmut) müssen den Unterhalt der Kinder abdecken, sodass den Familien durch Kinder keine finanzielle Belastung entsteht. Diese Entlastung der Familien ist kein Geschenk der öffentlichen Hand, sondern eine gerechte Mindestabgeltung für die Leistung, die durch die Betreuung und Erziehung der Kinder von den Familien für die ganze Gesellschaft erbracht wird. Dafür kann man von den Eltern verlangen, dass bei der Kinderbetreuung gewisse Standards nachgewiesen werden, etwa nach dem Modell des Eltern-Kind-Passes, der bereits 1974 eingeführt wurde. Partnerschaftliches Verhalten in den Familien ist durch geeignete Anreize zu fördern, insbesondere sollen einem Elternteil, der sich überwiegend der Familienarbeit widmet (Kinderbetreuung, Haushaltsführung, Pflege von Angehörigen) daraus keine Nachteile bei der Pension entstehen.
• Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund brauchen zum Erwerb der deutschen Sprache – die Voraussetzung für beruflichen Erfolg und soziale Integration – eine besondere Förderung durch kostenlose Sprachkurse. Dies ermöglicht, dass sie als Erwachsene vollwertige und geschätzte Mitglieder unserer Gesellschaft sind, die ihren Beitrag zum Sozialsystem leisten.
Teil 2: Menschen im Pensionsalter
Mit zunehmender Langlebigkeit wachsen für viele ältere und alte Menschen nicht nur die Chancen, sondern auch die Belastungen; sie sind an die äußeren Ränder sozialer Teilhabe gedrängt.
Vom Alter gibt es ein gesellschaftliches Bild, das von Defiziten, Kosten und Belastungen geprägt ist. Pflege, Unterstützung und Fürsorge werden politisch häufig nur als Kostenfaktor verbucht, statt als Ausdruck menschlicher Verbundenheit und als zentrale Aufgabe des Gemeinwohls verstanden. Viele ältere Menschen verinnerlichen diese Sichtweise – sie schämen sich ihrer Abhängigkeit und erleben ihr Alter nicht als legitimen Lebensabschnitt, sondern als Zumutung an sie selbst und durch sie selbst.
Frauen sind in Österreich überdurchschnittlich von Altersarmut betroffen – ein Ausdruck struktureller Ungleichheiten, die sich im Alter verschärfen.
• Für die Erhöhung des Pensionsalters unter der Bedingung, dass die Arbeitsbedingungen gut sind:
Man arbeitet nicht nur, um die Existenz zu sichern, sondern auch um die Persönlichkeit zu entfalten und soziale Anerkennung zu erreichen. Arbeit muss im Dienst des Menschen stehen, der Entfaltung der menschlichen Person dienen, einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten und den solidarischen Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Es ist bekannt, dass (sowohl bezahlte als auch ehrenamtliche) Arbeit im Alter in der Regel gesundheitsfördernd ist und der Demenz vorbeugt. Bei der Diskussion um die Anhebung des Pensionsalters sollte beachtet werden, dass Arbeit ein wichtiger Teil des Lebens ist und „nicht mehr arbeiten müssen“ dann nicht erstrebenswert ist, wenn die Arbeitsbedingungen gut sind.
Zur finanziellen Entlastung der nächsten Generation plädieren wir für eine Anhebung des Pensionsalters. Dabei sind die Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmer:innen so zu gestalten, dass Arbeit als sinnvolle Tätigkeit empfunden werden kann. Altersgerechte Arbeitsplätze und die Möglichkeit zur Altersteilzeit sollten angeboten werden.
• Gegen eine „Flat Tax“ für Zuverdienst neben der Pension:
Zuverdienst nach Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters sollte problemlos möglich sein. Die entsprechende Steuererklärung sollte unbürokratisch und handschriftlich auf einem übersichtlichen und verständlichen Formular möglich sein. Das Zusatzeinkommen sollte wie bisher zusammen mit der Pension besteuert werden (dh. Bezieher:innen höherer Pensionen haben auch einen höheren Steuersatz für das Zusatzeinkommen). Das auf Seite 22 des Regierungsprogramms (unter „Wirtschaft und Arbeit“) geplante Modell „Arbeiten im Alter“ mit genereller 25% - Endbesteuerung für Zusatzeinkommen ist unsozial und unwirksam, wir lehnen es daher entschieden ab.
Es begünstigt Personen mit sehr hohen Pensionen und/oder hohen Zusatzeinkommen. Personen mit sehr kleinen Pensionen und sehr niedrigen Zusatzeinkommen würden dadurch sogar höher als bisher besteuert werden. In Zeiten, in denen gespart werden muss, ein ganz schlechtes Signal. Die dafür veranschlagten 300 Mio. Euro sollten eingespart werden! Die „Flat Tax“ für das Zusatzeinkommen wird nur wenige zu mehr Arbeit neben der Pension motivieren: eine Studie des Arbeitsmedizinischen Zentrums in Hall in Tirol (siehe Thema des Tages „Die Alten am Arbeitsmarkt“ in der Tiroler Tageszeitung vom 10. November 2025, Seite 3, und ORF News vom 9. November 2025) unter Menschen, die in der Pension beruflich tätig sind ergab, dass 75% aus „Freude an der Arbeit“ weiterhin tätig sind und für weniger als 25% das Zusatzeinkommen wichtig ist. Bei diesen überwiegen Frauen, die eine sehr geringe Pension haben und von Altersarmut gefährdet sind (also von einer „Flat Tax“ nicht profitieren könnten).
Um die Motivation für Arbeiten im Alter zu steigern, wäre es vielmehr wichtig, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass die Arbeitnehmer:innen ihrer Arbeit gerne nachgehen können und auf Grund ihrer Erfahrung Möglichkeiten zur Mitbestimmung haben.
• Für die „gedeckelte“ Pensionserhöhung 2026:
Wir unterstützen die Vorgangsweise der Regierung für die Pensionserhöhung 2026: die „unteren 70% der Pensionen“ werden um die Inflationsrate erhöht, die höheren Pensionen erhalten nur einen Fixbetrag (der geringer als die Inflationsabgeltung ist). In schwierigen Zeiten müssen Personen mit höherem Einkommen stärker zur Finanzierung der Staatsausgaben herangezogen werden als solche mit niedrigem Einkommen, das entspricht der christlichen Soziallehre.
• Förderung des Ehrenamtes: Wir begrüßen die Wertschätzung des Ehrenamtes im Regierungsprogramm (im Abschnitt „Gesellschaft und Zusammenleben“). Dafür sollten sozial aktive Vereine durch die öffentliche Hand gefördert werden, insbesondere durch die Übernahme von Haftpflicht- und Unfallversicherung für die ehrenamtlich Tätigen.
• Alte Menschen sind auch dann noch wertvoll, wenn sie nicht mehr arbeiten können:
Städte und Dörfer werden sicherer, wenn dort viele alte Menschen (mit oder ohne Hund) spazieren gehen oder auf einer Bank sitzen. Sie zeigen, dass auch Personen, die nicht mehr im engeren Sinn leistungsfähig und aktiv sein können, Wert haben – eine wichtige Erfahrung gerade auch für Kinder und Jugendliche. Wir unterstützen die im Regierungsprogramm unter „Generationengerechtes Zusammenleben“ angeführten Maßnahmen.
Insbesondere die Errichtung von Flächen und Räumen für konsumfreie Aufenthalte mit seniorengerechten Sitzgelegenheiten und WC-Anlagen erscheint uns wichtig, dadurch werden Orte lebendiger – nicht nur für Senior:innen. Ein entsprechender Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel muss dafür sorgen, dass alte Menschen noch mobil bleiben (ein wichtiges Mittel gegen Vereinsamung!), wenn sie nicht mehr Auto fahren können.
• In Würde krank sein und sterben können:
Für die Pflege kranker und sterbender Menschen müssen ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden. Neue Wohnformen – zum Beispiel für Menschen mit Demenz - sollten frühzeitig gefördert werden. Wichtig ist, dass pflegende Angehörige besser geschützt und ihre Leistung für die Gesellschaft anerkannt werden, zum Beispiel durch die Anrechenbarkeit der Zeiten für die Pflege von Angehörigen für die Pension. Durch das HosPal Fonds-Gesetz gibt es Mittel für die spezialisierte Hospiz-und Palliativversorgung. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, dass diese Mittel auch in Pflegeheimen, Krankenhäusern, bei Hausärzten und Sozialsprengeln wirkungsvoll ankommen. Es darf nicht sein, dass es – wie bereits in Deutschland - „privilegiertes“ Sterben für wenige Menschen in Hospizen gibt und das „normale“ Sterben für viele überall sonst.
Teil 3: Menschen im Erwerbsleben
in Arbeit
Für den Inhalt verantwortlich: Gesellschaftspolitischer Arbeitskreis der Katholischen Aktion der Diözese Innsbruck
z. Hd. Franz Pauer, 6020 Innsbruck, Dorfgasse 9g
kav@dibk.at , Tel. 0664 73787822
http://www.dibk.at/kav