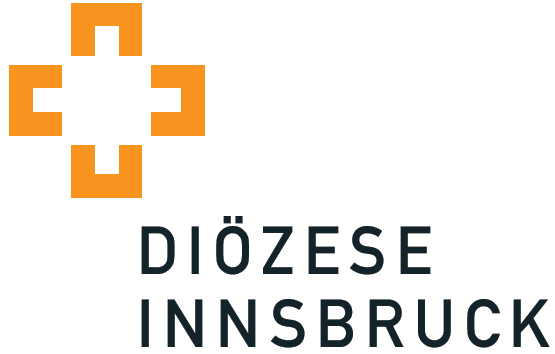Stichworte
A
Achtsame Kommunikation
Das Wort Kommunikation ist verwandt mit den lateinischen Begriffen communio (Gemeinschaft) und unio (Einheit). Diese Verwandtschaft weist auf das Ziel der Achtsamen Kommunikation hin. Sie möchte mit Hilfe der Sprache und des Zuhörens aufrichtige, einfühlsame Beziehungen und Verbundenheit untereinander aufbauen. Die Vision ist eine neue Kultur der Begegnung in Respekt und gegenseitiger Wertschätzung.
Alle Informationen zum Weg der Achtsamen Kommunikation finden Sie unter dem folgenden Link.
Advent
Das Wort Advent bedeutet "Ankunft" (lat. adventus Domini = Ankunft des Herrn). Die Kirche wartet in diesen Wochen auf das Fest der Geburt Jesu Christi, das am Heiligen Abend (24. Dezember) und am Weihnachtstag (25. Dezember) gefeiert wird.
Eine eigene Adventzeit als besinnliche Vorbereitung auf das Weihnachtsfest (in Anlehnung an die vorösterlich Fastenzeit) wurde seit dem vierten Jahrhundert zuerst in Spanien und Gallien, später im ganzen Abendland begangen. Die Ostkirchen kennen keine Adventzeit. Papst Gregor der Große (540-604) hat die noch heute gültige Länge der Adventszeit festgelegt. Der erste der vier Adventsonntage fällt auf den Sonntag zwischen 27. November und 3. Dezember. Der vierte Adventsonntag kann daher spätestens auf den 24. Dezember fallen.
Für katholische Christen ist der Advent ein Zeit der Besinnung und Buße. Das verdeutlicht auch die liturgische Farbe Violett. Am dritten Adventsonntag, der auch "Gaudete" (= "Freut euch!") genannt wird, steht die Freude über die baldige Ankunft des Herrn im Mittelpunkt.
Die ist wie keine andere Zeit von religiösem Brauchtum geprägt: Adventkranz (kommt ursprünglich aus dem evangelischen Bereich), Herbergsuchen, die Feier der Rorate, das Anklöpfeln, der Adventkalender prägen in vielen Pfarren und Familien das religiöse Leben in dieser Zeit. In Tirol von besonderer Bedeutung ist zum Ende des Advents das Aufstellen der Weihnachtskrippen in Kirchen, Kapellen und Häusern. Viele Häuser, vor allem in den Dörfern, stehen in dieser Zeit auch Besuchern offen, die die Krippen anschauen wollen.
Das Familienreferat der Diözese Innsbruck hat viele Gestaltungsvorschläge für den Advent und für die Weihnachtszeit, die auch in einer Broschüre in der Reihe "Familien feiern Feste" erschienen sind.
Allerheiligen und Allerseelen
Allerheiligen
Das Fest Allerheiligen wird am 1. November gefeiert. Es geht zurück auf Papst Gregor III., der eine Kapelle in der römischen Basilika St. Peter allen Heiligen geweiht hat. Im 9. Jahrhundert wurde das Fest auf die gesamte Kirche ausgedehnt.
Als Heilige gelten Menschen, die ihr Leben in nachahmenswerter Weise geführt haben und deren Glaube ein Vorbild für andere ist. Vor allem Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt oder gar getötet wurden, werden als Heilige verehrt. Die Heiligenverehrung reicht zurück bis in die ersten Jahrhunderte des Christentums. Bereits damals riefen die Menschen die Heiligen um Fürsprache bei Gott an.
Allerseelen
Das Fest Allerheiligen wird in Österreich als Feiertag begangen. Daher wurde die Segnung der Gräber, die zum Allerseelentag am 2. November gehört, auf den Nachmittag des Allerheiligenfestes verlegt.
Der Ursprung des Allerseelenfestes geht auf das 9. Jahrhundert nach Christus zurück. An diesem Tag wird aller Toten gedacht und für sie gebetet. Wesentlich zur Ausbreitung des Festes beigetragen hat das französische Kloster Cluny. Abt Odilo von Cluny hat diesen Gedenktag im Jahr 998 in allen von Cluny abhängigen Klöstern eingeführt. Bald wurde der Allerseelentag auch außerhalb der Klöster gefeiert.
Zu Allerseelen gedenkt die Kirche jener Menschen, die bereits gestorben sind. Die Gebete sind getragen von der Hoffnung, dass diese Menschen bei Gott sind und alles, was in ihrem Leben unvollendet und unvollkommen geblieben ist, in Gott vollendet wird.
Alten- und Pflegeheime
Alten- und Pflegeheimseelsorge geschieht in der Begleitung der HeimbewohnerInnen (Gespräch, Berührung, Gebet, Sterbebegleitung…) sowie von deren Angehörigen (entlastende Gespräche, Verabschiedung von Verstorbenen…), in der Zusammenarbeit mit dem Heimpersonal sowie mit anderen haupt- oder ehrenamtlichen Diensten, in der Feier der Liturgie (Gottesdienste, Andachten, Krankensalbung…), und in der Mitgestaltung einer Lebenskultur im Heim.
Alten- und Pflegeheimseelsorge
Alter - Altern
Als Alter wird neben dem kalendarischen Lebensalter auch jener Lebensabschnitt bezeichnet, der sich vom Ende des mittleren Erwachsenenalters bis zum Tod erstreckt. Das Alter ist eine immer länger werdende und daher keine einheitliche Lebensphase mehr. Deshalb unterscheidet Paul B. Baltes zwischen dem 3. Alter (60 – 80) und dem 4. Alter (ab ca. 80, wenn Hilfe- und Pflegebedürftigkeit eintreten). Auch kollektiv- und individualgeschichtliche Ereignisse prägen Altersgruppen in ihren Lebensstilen, Lebenseinstellungen und Lebenslagen und bilden Generationen. Die alten Menschen gibt es deshalb nicht, die Menschen im Alter sind sehr unterschiedlich. Zudem stößt das Alter als Bezeichnung für das eigene Lebensalter aufgrund vorwiegend negativer Zuschreibungen/Altersbilder vielfach auf Ablehnung.
Altern meint den ständigen Prozess des Älterwerdens.
Arbeit und Wirtschaft
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:
Aschermittwoch
Mit dem Aschermittwoch beginnt in der Katholischen Kirche die Fastenzeit in Vorbereitung auf das Osterfest. Der Name dieses Festes hat damit zu tun, dass den Gläubigen in den Messfeiern dieses Tages ein Aschenkreuz auf die Stirn gezeichnet wird. Die geweihte Asche ist ein Symbol für die Vergänglichkeit des Menschen, zugleich aber auch für Reinigung und Erneuerung. Die Asche für den Aschermittwoch wird durch das Verbrennen von Palmzweigen gewonnen, die am Palmsonntag des Vorjahres gesegnet wurden.
Am Aschermittwoch erinnert die Kirche an die Vergänglichkeit des Lebens
Mit dem Aschermittwoch beginnt die 40 Tage dauernde Fastenzeit, die mit dem Ostersonntag endet. Bei dieser Zählung werden die Sonntag nicht mitgezählt, da sie nach christlicher Tradition nicht zur Fastenzeit zählen. Die Zahl 40 erinnert an die 40 Tage, die Jesus nach seiner Taufe in der Wüste gefastet hat, und an die 40 Jahre, die das Volk Israel nach seinem Auszug aus der Sklaverei Ägyptens durch die Wüste gewandert ist. Diese Zeiten der Wüste stehen für Zeiten der Entbehrung, aber auch der Versuchung. Daher ist die Fastenzeit eine Einladung, das eigene Leben neu zu überdenken und neue Wege einzuschlagen. Viele Menschen verzichten während der Fastenzeit ganz bewusst auf Genussmittel (Zigarette, Alkohol, Süßigkeiten) oder auf das Essen von Fleisch.
Im Evangelium zum Aschermittwoch (Mt 6, 1-6.16-18) wird deutlich, dass es beim Fasten nicht um eine Kasteiung des Körpers und um ein freudloses Leben geht. Vielmehr heißt es im Evangelium (Verse 16-18): "Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht; und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten."
AV-Medien
Medien (Filme, Dias, Dokus,...) spielen eine wichtige Rolle in der religiösen und weltanschaulichen Bildung. Das gilt in der Schule ebenso wie in den Pfarrgemeinden, in der Jugend- und Erwachsenenbildung. In der Diözese Innsbruck bietet die AV-Medienstelle Dienstleistungen und Service für die Arbeit mit Medien an. Schwerpunkte der Arbeit sind der Verleih und Verkauf von Medien und Behelfen, Medienpädagogik sowie die Betreuung der 11 Dekanatsmedienstellen.
B
Behinderte Menschen
Menschen mit Behinderung sind Teil der Vielfalt menschlichen Lebens. Die Diözese Innsbruck ist bemüht, mit speziellen Angeboten auf die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung einzugehen, Barrieren und Vorurteile abzubauen.Die Arbeitsgemeinschaft Seelsorge für Menschen mit Behinderung bemüht sich die Familienangehörigen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und die Pfarrgemeinden zu unterstützen und mit speziellen Angeboten die besondere Zuwendung Gottes erlebbar zu machen.
Beratung / Seelsorge
Die Dienststellen und Einrichtungen der Diözese Innsbruck bieten seelsorgliche Hilfe und Begleitung in vielen Lebenslagen. Beratungseinrichtungen stehen kostenlos und ohne Voranmeldung für Gespräche zur Verfügung.
Berufe der Kirche
Vom Priester über PastoralassitentInnen, PfarrhaushälterInnen bis hin zu MitarbeiterInnen in diözesanen Einrichtungen und ReligionslehrerInnen – Reichhaltig ist die Palette der Berufe in der Kirche. Die Reihe der Berufe beziehungsweise Berufungen will etwas von der Vielfalt der Dienste in der Kirche sichtbar machen und Suchenden helfen, sich zu orientieren.
Berufung
Als "Berufung" wird im engeren Sinn der Anruf Gottes verstanden, sich für ein Leben als Priester, Ordensmann oder Ordensfrau zu entscheiden. Weiter gefasst verseht man darunter die Berufung jedes getauften Menschen, sich an seinem Ort und in seinem Leben für die Verwirklichung der christlichen Botschaft einzusetzen.
Beschäftigungsprojekt "Eine Chance in und mit der Kirche"
Arbeitslosigkeit ist ein Thema, das uns alle betrifft und berührt. In dieser schwierigen Zeit sind auch wir in der Kirche aufgefordert, konkrete Schritte zu setzen. An vielen Orten innerhalb der Kirche können wir einen konkreten Beitrag setzen und Menschen ohne Erwebsarbeit durch ein überschaubares Betätigungsfeld mit geregeltem Einkommen eine Chance geben, damit sie wieder zurück in das normale Berufsleben finden.
Das Projekt "Eine Chance in und mit der Kirche" gibt arbeitslosen Menschen für einen befristeten Zeitraum eine Anstellung in einem überschaubaren Betätigungsfeld mit geregeltem Einkommen. Im besten Falle werden sie von der jeweiligen kirchlichen Einrichtung in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis übernommen.
Betriebsrat
Der Betriebsrat hat entsprechend der Arbeitsverfassung die Aufgabe, die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der ArbeitnehmerInnen im Betrieb wahrzunehmen und zu fördern. Grundsätzlich ist das kollektive Arbeitsrecht und die Aufgaben des Betriebsrates über das Arbeitsverfassungsgesetz geregelt.
Zum Internetauftritt des Betriebsrats
Betriebsseelsorge
Betriebsseelsorge will Menschen am Arbeitsplatz erreichen und sie im Arbeitsleben unterstützen. Sie erkennt die Zeit des Erwerbslebens als wesentlichen Teil des menschlichen Lebens an. Gemeinsam mit den arbeitenden Menschen beteiligt sich die Betriebsseelsorge am Aufbau gerechter Strukturen in der Arbeitswelt. Ihre Grundlage findet die Betriebsseelsorge in der Soziallehre der Katholischen Kirche. Darin ist deutlich formuliert, dass der Mensch nicht für die Arbeit da ist sondern die Arbeit für den Menschen.
Bibel
Das Wort "Bibel" kommt vom griechischen "biblion" und bedeutet "Papyrusrolle". Streng genommen handelt es sich dabei um eine Sammlung von 73 Büchern, die in das sog. "Alte Testament" oder auch "Erste Testament" (46 Schriften) und das "Neue Testament" (27 Schriften) unterteilt werden.
Das Erste Testament spiegelt eine beinahe 2000 Jahre umfassenden Zeitraum wider. Die Schriften des Neuen Testaments sind dagegen innerhalb von ca. 100 Jahren entstanden. Die biblischen Schriften wurden in einem Zeitraum von etwa 1.200 Jahren verfasst. Gegen Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus entstand jener Kanon an biblischen Schriften, die heute die Bibel bilden.
Die Bibel ist das mit Abstand am häufigsten gedruckte Werk der Weltliteratur und ist in unzähligen Sprachen erschienen. In deutscher Sprache liegt die Bibel seit dem Mittelalter vor. Größere Verbreitung fand erstmals die Übersetzung von Martin Luther aus den Jahren 1522 bis 1535.
Im Internet sind zahlreiche Online-Ausgaben der Bibel abrufbar. Als Beispiel dafür die Internetausgabe der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck: Online-Bibel
Bibliotheksservice
Eine lebendige Pfarrgemeinde wird vor allem auch durch eine gelungene Kommunikation, durch Informationsaustausch und gegenseitige Dienste getragen.Als "Biotope des Geistes" sind die öffentlichen Bibliotheken in katholischer Trägerschaft oder Mitträgerschaft für die Pfarrgemeinde ein wichtiger Bestandteil im Auftrag der Verkündigung.
In den Pfarren und Gemeinden wird die Bibliotheksarbeit überwiegend von ehrenamtlich tätigen MitarbeiterInnen getragen. Die Diözese unterstützt über dasBibliotheksreferat die Bibliotheken ideell, fachlich und finanziell.
Bildungseinrichtungen
Bildung eröffnet neue Perspektiven. Ob ein besinnliches Wochenende oder ein Vortrag über soziale und gesellschaftliche Fragen: wer sich weiterbildet, bleibt lebendig und öffnet sich den Herausforderungen der Welt. Die Diözese Innsbruck stellt mit zwei Bildungshäusern, dem Katholischen Bildungswerk Tirol und vielen weiteren Einrichtungen einen wesentlichen Faktor in der Bildungsarbeit in Tirol dar.
Informieren Sie sich über die aktuellen Veranstaltungen im Terminkalender auf dieser Homepage.
Bischof
Als Bischof wird in der Katholischen Kirche der Vorsteher einer Ortskirche (Diözese) bezeichnet. Die Amtsnachfolge eines Bischofs geht nach kirchlicher Tradition unmittelbar auf die Apostel zurück. Dem Bischof ist die Weihe von Priestern vorbehalten, die in seinem Auftrag Gottesdienste feiern und predigen.
Am 14. Dezember 2003 wurde Manfred Scheuer im Dom zu St. Jakob zum Bischof der Diözese Innsbruck geweiht. Scheuer folgte somit seinem Vorgänger Alois Kothgasser, der zum Erzbischof von Salzburg bestellt wurde.
Blind
Das Blindenapostolat ist eine Organisation der Katholischen Aktion für Blinde, Sehbehinderte und deren Angehörige. Der Leiter des Tiroler Blindenapostolates ist selber blind und kennt daher die Probleme und Bedürfnisse der Blinden aus eigener Erfahrung.
C

Caritas
Die Caritas der Diözese Innsbruck ist als Teilorganisation der katholischen Kirche lokal und international tätig. Für die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas hat jeder Mensch das Recht auf ein Leben in Würde. Das Beispiel Jesu, das Engagement für eine solidarische Gesellschaft und die Wahrung menschlicher Eigenverantwortung sind für uns und unsere Hilfsangebote zentrale Werte.
"caritas" (lateinisch für Hochachtung und Liebe) ist das engagierte und uneigennützige Handeln der Christen für Menschen in Not.
D
Diakonaler Dienst
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:
Dom zu St. Jakob
Der Dom zu St. Jakob in Innsbruck zählt zu den bedeutensten barocken Bauwere der Landeshauptstadt. Der Bau besticht vor allem durch seine ausgewogenen Proportionen und die kunsthistorischen Details.
Die erste urkundliche Erwähung der Jakobskirche in Innsbruck ist in einem Ablassbrief aus dem Jahr 1270 dokumentiert. Die älteste bekannte Ansicht des gotischen Kirchenbaus ist eine Zeichnung von Albrecht Dürer aus den Jahren 1494/95.
Das Gnadenbild Mariahilf
Bekannt ist der Innsbrucker Dom vor allem auch für das Gnadenbild „Mariahilf“, gemalt von Lukas Cranach d. Ä. um 1537. Es nahm seinen Weg von der Dresdner Heiligkreuzkirche in die Kurfürstliche Gemäldesammlung. Kurfürst Georg I. von Sachsen gab dieses Gemälde Erzherzog Leopold V. als Geschenk, der zuerst Bischof von Passau, später Landesfürst von Tirol war. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde dieses Gemälde öffentlich bei Marienandachten verehrt. Auf diese Weise kam es 1650 zur Verehrung in die damalige Stadtpfarrkirche. Nach dem Neubau erhielt es seinen Platz am Hochaltar. Es ist das am weitesten verbreitete Marienbild im alpenländischen, mitteleuropäischen Raum.
Grabdenkmal von Erzherzog Maximilian III.
Das Grabdenkmal zeigt auf einem viersäuligen Aufbau den Deutschmeister Maximilien, der vom hl. Georg (Patron des Deutschen Ritterordens) beschützt wird. Die Inschrift auf der Grabplatte rechts erinnert an Erzherzog Eugen, den letzten Hochmeister des Deutschen Ordens aus dem Hause Habsburg, der hier seine letzte Ruhestätte fand.
Glockenspiel
Das Friedensglockenspiel im Nordturm des Domes ist das erste vieroktavige Österreichs. Es umfasst 48 Glocken mit einem Tonumfang von 4 Oktaven. Sämtliche Glocken wurden von der Königlichen Glockengießerei Eijsbouts in Asten (Niederlande) gegossen. Das Glockenspiel ist täglich um 12.15 Uhr zu hören.
Ausführlichere Informationen: Dompfarre St. Jakob
E
EDV - Datenverarbeitung
Elektronische Medien und Kommunikationsmittel prägen mehr denn je den beruflichen und auch privaten Alltag vieler Menschen. Die Abteilung Datenverarbeitung der Diözese berät und betreut diözesane Dienststellen und Pfarrgemeinden in Fragen der Informations- und Kommunikationstechnologie.
Eheannullierung
Da eine gültig geschlossene und vollzogene Ehe unauflösbar ist, kann es eine kirchliche Ehescheidung nicht geben. Es gibt jedoch Fälle, in denen bei der Trauung gar keine gültige Ehe zustande kam. Ein kirchliches Gericht kann daher nach sorgfältiger Prüfung des Sachverhalts zu der Feststellung gelangen, dass ein Eheband von Anfang an niemals bestanden hat. Diese Feststellung nennt man Ehenichtigkeitserklärung oder Eheannullierung.

Ehevorbereitung
Sportler bereiten sich auf den Wettkampf sorgfältig vor. Viele Menschen investieren Zeit und Geld in berufliche Aus- und Weiterbildung. Auch auf ein gemeinsames Leben in einer Ehe kann und soll man sich vorbereiten. Eine dauerhafte, von Wertschätzung und Liebe geprägte Ehe ist wie ein Dach für die Seele. Die Diözese Innsbruck hat ein vielfältiges Angebot für Paare zur Stärkung ihrer Beziehung.
Ehrenamt
Menschen, die ihre Fähigkeiten und ihre Zeit für andere Menschen zur Verfügung stellen, ohne dafür eine Bezahlung zu verlangen, werden in unserer Gesellschaft und in der Kirche immer wichtiger. Ehrenamtliche sind gefragt. Sie stellen ihre Zeit und ihre Kreativität zur Verfügung, nehmen Herausforderungen an und leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Gemeinschaft.
Ehrenamtlich tätige Menschen brauchen für ihren Dienst auch eine gute Begleitung, Wertschätzung von Seiten der Einrichtungen, in denen sie tätig sind. Im Download stellen wir Ihnen die "Charta für Ehrenamtliche" der Diözese Innsbruck zur Verfügung. Sie bietet Informationen zur ehrenamtlichen Tätigkeit, Mustervorlagen für Vereinbarungen, Urkunden, Tätigkeitsnachweise usw. Eine Papierversion der Charta ist erhältlich in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation der Diözese Innsbruck, Tel. 0512/2230-2211.
Weitere Infos und die Charta als PDF zum Download
Elternbildung
Mit den Angeboten der Elternbildung werden Mütter und Väter begleitet und unterstützt in Ihrer Aufgabe als Erziehende. Sie vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten, die zu einer bewussteren Auseinandersetzung und Gestaltung von Beziehungs- und Erziehungsprozessen führen.
Entwicklungszusammenarbeit
Ein zentraler Auftrag der Kirche besteht in der weltweiten Solidarität mit den Armen und Unterdrückten. In vielen Ländern der Erde sind diözesane Hilfswerke tätig, um das Gesundheitssystem zu verbesssern, für lebensnotwendiges Wasser zu sorgen oder die sozialen Strukturen zu stärken. Im Mittelpunkt aller Bemühungen steht die Hilfe zur Selbsthilfe.
Erstkommunion
Das erste Mal zur Kommunion zu gehen, ist für Kinder ein prägendes Ereignis. Mit gut acht Jahren sind die Kinder verständig genug, um den Leib Christi zu empfangen. Die Vorbereitung zur Erstkommunion wird in Familie, Pfarre und Schule meist mit viel Liebe und Sorgfalt gestaltet. Jährlich empfangen in der Diözese Innsbruck ca. 4.500 Kinder das erste Mal die Kommunion.
Erwachsenenbildung
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:
Exerzitien
Exerzitien sind religiöse Übungen, die dabei helfen, ein bewusstes Leben aus dem Glauben zu führen und sein Leben nach dem Willen Gottes auszurichten. Exerzitien bieten Zeit für das persönliche Gebet, für Austausch in der Gruppe, oft auch für Körper- und Atemübungen.
Eine besondere Form der Exerzitien sind die „Exerzitien im Alltag“, die während der Fastenzeit in vielen Pfarrgemeinden angeboten werden. Diese Form der Exerzitien richtet den Blick bewusst auf die Gestaltung des Lebens aus dem Glauben. Elemente sind ein bewusster Tagesbeginn, Übungen für die Aufmerksamkeit, tägliche Gebetszeiten und regelmäßige Treffen in der Exzitiengruppe.
F
Familie
In der Familie werden die religiösen und sozialen Werte grundgelegt, in ihr werden heranwachsende Menschen geprägt wie nirgendwo sonst. Auch den Zugang zu einem persönlichen Glauben können Familien am besten vermitteln. Diözesane Einrichtungen bieten dazu Hilfestellungen in unterschiedlichster Form.
Fastenzeit
Die Fastenzeit beginnt in der katholischen Kirche mit dem Aschermittwoch und dauert 40 Tage. Diese Zeit dient der bewussten Vorbereitung auf das Osterfest, dem höchsten Feiertag der katholischen Kirche. In der Fastenzeit verzichten viele Menschen bewusst auf Genussmittel, um für das Wesentliche im Leben frei zu werden.
Die Fastenzeit geht auf Jesus zurück, der vor seinem ersten öffentlichen Auftreten 40 Tage lang in der Wüste gefastet hat.
Ferien, Urlaubsfahrten
Leben braucht Spannung und Entspannung. Wer nicht abschalten kann, dem geht auch die Motivation in der Arbeit verloren. So wie der Sonntag im Rhythmus der Woche, bilden Ferien und Urlaub Freiräume, um Kraft zu schöpfen und Gemeinschaft in Familie oder Freundeskreis zu pflegen.
In der Diözese Innsbruck bietet die Kirchenzeitung Tiroler Sonntag jedes Jahr Reisen und Pilgerfahrten an.
Pilgern und Reisen mit dem Tiroler Sonntag
Firmung
Das Sakrament der Firmung bildet zusammen mit Taufe und Erstkommunion die Einführungssakramente der Katholischen Kirche. Die Gabe des Heiligen Geistes, die sich in Handauflegung des Bischof (bzw. seines Vertreters) und Salbung mit Chrisam ausdrückt, soll der Firmling stärken und noch mehr an die Kirche binden.
In der Diözese Innsbruck empfangen junge Menschen üblicherweise im Alter zwischen 12 und 14 Jahren das Sakrament der Firmung. Der Besuch einer Firmvorbereitung ist verpflichtend. In manchen Pfarren wird das Modell „Firmung ab 17 Jahre“ durchgeführt. Die Firmlinge werden in einem speziellen Glaubenskurs auf das Sakrament vorbereitet.
Wenn möglich sollen sich junge Menschen in ihrer Heimatpfarre firmen lassen. Ansonsten müssen sie sich beim Pfarrer des gewünschten Firmortes rechtzeitig anmelden.
Patenschaft
Dem Firmling wird ein Pate bzw. ein Patin zur Seite gestellt. Die Patenschaft soll seine religiöse Entwicklung fördern.
Ein Firmpate bzw. eine Firmpatin muss katholisch sein. Er bzw. sie hat Erstkommunion und Firmung empfangen und das 16. Lebensjahr vollendet. Die gewählte Person führt ein Leben nach dem Glauben. Sie ist nicht aus der Kirche ausgetreten bzw. ausgeschlossen worden.
Ein evangelisch Getaufter kann die Patenschaft nicht übernehmen, aber gemeinsam mit einem katholischen Paten als Firmzeuge auftreten.
Im Kirchenrecht wird empfohlen, dass dieselbe Person das Patenamt für Taufe und Firmung übernimmt.
Frauen
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:
Freiwilligenarbeit
Viele Bereiche des gesellschaftlichen, kirchlichen und sozialen Lebens wären ärmer oder würden gar nicht funktionieren, wenn die Arbeit nicht von Freiwilligen getragen oder mitgetragen wird. Ob bei der Feuerwehr, im Rettungswesen, in Alten- und Pflegeheimen, in Sozialkreisen, Vinzenzvereinen oder bei Sozialprojekten: Das soziale Gefüge ist auf die Mithilfe von Menschen angewiesen, die ihren Dienst unentgeltlich leisten.
Um diese Menschen zu begleiten, Kontakte zwischen Freiwilligen und Einrichtunge herzustellen und die Qualität der Freiwilligenarbeit zu sichern, haben sich in vielen Diözesen Freiwilligenzentren gebildet. Das Freiwilligenzentrum Tirol (getragen von den Barmherzigen Schwestern Innsbruck und der Caritas Tirol) will Menschen zusammenführen: Menschen, die Hilfe brauchen und Menschen, die gerne helfen wollen.
In Tirol bietetn rund 150 Einrichtungen insgesamt 500 Einsatzstellen für Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen. Das Freiwilligenzentrum hilft bei der Vermittlung, bietet Fort- und Weiterbildungen für Begleitpersonen in den Einrichtungen, religiöse Forbildung für Freiwillige und leistet Lobbyarbeit für die Freiwilligenarbeit.
Das Wesen der Freiwilligenarbeit besteht darin, dass jemand unentgeltlich und regelmäßig für einen vereinbarten Zeitrum seine Zeit und Arbeitskraft zur Verfügung stellt, um in sozialen Einrichtungen und Initiativen zu arbeiten.
Sie wollen sich freiwillig für Menschen in ihrer Heimat engagieren? Mehr Infos dazu auf: www.freiwillige-tirol.at
Fronleichnam
Das Fest "Fronleichnam" wird am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. An diesem Festtag feiert die Katholische Kirche den Glauben an die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie.In den meisten Tiroler Gemeinden ist das Fronleichnamsfest geprägt von einer feierlichen Prozession. Bei diesem Rundgang durch das Dorf wird das eucharistische Brot in einer Monstranz vom Priester oder Diakon mitgetragen. An vier Stationen während der Prozession werden Texte aus der Bibel gelesen und der Priester spendet den Segen. Der Donnerstag als Termin knüpft an an den Gründonnerstag der Karwoche, an dem die Kirche der Einsetzung der Eucharistie durch Jesus Christus gedenkt. Die Ursprünge von Fronleichnam reichen zurück ins 13. Jahrhundert. 1264 hat Papst Urban IV das Fronleichnam als allgmeines Kirchenfest zur Verehrung der Eucharistie eingeführt.Die Anregung zum Fronleichnamsfest stammt von der Mystikerin Juliana von Lüttich. Der Name "Fronleichnam" leitet sich vom mittelalterlichen "Fron" für Herr und "lichnam" für den lebendigen (!) Leib Christi ab. Das Fest hat also mit "Frondienst" oder gar mit dem Wort "Leichnam" nichts zu tun.In der Zeit der Gegenreformation wurde Fronleichnam zu einer Machtdemonstration gegenüber den Anhängern von Martin Luther, der dieses Fest aufgrund der damaligen Verbindung mit dem Ablasshandel ablehnte.
G
Gehörlos
Für Gehörlose (früher sagte man Taubstumme) stellt die Kirche einen eigenen Gehörlosenseelsorger bereit, der in der Gebärdensprache kompetent ist und für sie da ist.
Gehörlosenseelsorge
Geschieden-Wiederverheiratete
Menschen , deren Ehe zerbrochen ist, sollen in der Kirche Verständnis und Heimat finden. Wenn Sie einen Neuanfang in einer neuen Partnerschaft wagen, sollen sie in Frieden in und mit der Kirche leben können.
Gleichstellung
Die Kirche ist überzeugt von der gleichen Würde und dem gleichen Wert von Frauen und Männern, begründet in der Gottebenbildlichkeit (Gen 1,26-27). Die gleiche Würde vor Gott leitet sich von der Taufe her ab, wie sie im Galaterbrief beschrieben wird (Gal 3,26-28). Das Reich Gottes ist durch Jesus unterschiedslos für Frauen und
Männer verkündet.
In der dogmatischen Konstitution über die Kirche heißt es: „Es ist also in Christus und in der Kirche keine Ungleichheit aufgrund von Rasse und Volkszugehörigkeit, sozialer Stellung oder Geschlecht“ (Lumen Gentium 32). Das Kirchenrecht sagt dazu: „Unter allen Gläubigen besteht, und zwar aufgrund ihrer Wiedergeburt in Christus, eine wahre Gleichheit in ihrer Würde und Tätigkeit, kraft der alle je nach ihrer eigenen Stellung und Aufgabe am Aufbau des Leibes Christi mitwirken.“ (c.208 CIC/1983)
Das Kirchenrecht macht – außer im Bereich des Weiheamtes – keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen in ihrer Stellung als Gläubige mit einem Sendungsauftrag für diese Kirche aufgrund der zugesagten Gotteskindschaft und dem Anteil am gemeinsamen Priestertum. Um als Kirche glaubwürdig zu sein, ist es unverzichtbar, dass diese Überzeugung und diese Vision auch in der Struktur der diözesanen Ämter und Einrichtungen und in der Kultur des Miteinander wiedergefunden, abgebildet und gelebt wird.
Gründonnerstag
In den vier Evangelien wird geschildert, wie Jesus am Abend vor seinem Kreuzestod seine Jünger um sich sammelt und mit Ihnen Mahl hält. Dieses Ereignisses gedenkt die christliche Kirche am Gründonnerstag.
Das letzte Abemdmahl Jesu ist auch der Ursprung der Eucharistiefeier. Zentrale Symbole dieses Tages sind Brot und Wein, die nach den biblischen Berichten Jesus an seine Jünger weitergegeben hat. Die Wandlungsworte, die in den Gottesdiensten gesprochen werden, gehen auf diese Berichte zurück.
Am Gründonnerstag schweigen als Zeichen der Trauer die Glocken. Der Volksmund sagt, "die Glocken sind nach Rom geflogen". Auch die Orgel erklingt erst wieder in der Osternacht. Statt der Glocken rufen ab nun in manchen Orten die „Ratschen“ zum Gottesdienst. In vielen Gemeinden ziehen Jugendliche mit Ratschen durch die Straßen.
Der Name "Gründonnerstag" leitet sich höchstwahrscheinlich vom althochdeutschen Wort "greinen" ab, das "weinen" bedeutet. Ein zentrales Element der Gründonnerstagsfeier ist in vielen Pfarrgemeinden die sog. "Fußwaschung". Dabei waschen ausgewählte VertreterInnen der Pfarrgemeinde einander die Füße, so wie es die Evangelien auch von Jesus berichten, der seinen Freunden beim Letzten Abendmahl die Füße gewaschen hat.
H

Herz-Jesu-Verehrung
Das Herz Jesu spielt in Tirol schon seit den Zeiten der Gegenreformation eine große Rolle in der Volksfrömmigkeit. Als im Juni 1796 Napoleon Bonaparte das erste Mal auf Tirol marschierte, gelobten die Tiroler Landstände dem Herz Jesu in der Bozner Pfarrkirche die jährliche Verehrung mit einer Prozession. Der Sieg in der Schlacht von Spinges 1797 wurde dann auch dem Schutz durch das Herz Jesu zugeschrieben. Das 1896 komponierte und getextete Lied "Auf zum Schwur, Tiroler Land" gehöre zum "Urbestand" der Herz-Jesu-Verehrung in Tirol, erklärte am 13. Juni 1999 der heutige Erzbischof Kothgasser beim offiziellen Herz-Jesu-Gelöbnisgottesdienst des Landes Tirol in der Innsbrucker Jesuitenkirche.
Herz-Jesu-Verehrung
Wenn seit 1809 Tiroler in den Krieg zogen, dann immer mit dem Segen des Herzens Jesu. In den Krisenjahren 1848, 1859, 1866, 1914 - aber auch noch im Gedenkjahr 1984 - erneuerte das Land Tirol offiziell den Bund mit dem Herz Jesu. Die Kombination aus Berufung auf die Freiheitskämpfer einerseits und der göttlichen Fürsprache andererseits wurde zum Leitbild Tiroler Soldatentums. Ende des 19. Jahrhunderts bekam die Herz-Jesu-Verehrung im Kulturkampf des Katholizismus gegen liberal-nationale Ideen neue Dynamik, das Bergfeuerwesen wurde als Gegenstück zu den Sonnwendfeuern eingeführt. Die Herz-Jesu-Verehrung wurde auch benützt, um politischen Ideen Nachdruck zu verleihen: etwa 1946 beim Versuch der Wiedervereinigung der beiden Tiroler Landesteile, oder auch in der 'Bozner Feuernacht', die in der Herz-Jesu-Nacht 1961 inszeniert wurde.
Herz-Jesu-Fest
Das Land Tirol war im 18. Jahrhundert trotz des Verbots durch das josephinische Regime und der Ideen des damals vorherrschenden Zeitgeistes der Herz-Jesu-Verehrung treu geblieben. Die Anfänge der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu finden sich im 13. und 14. Jahrhundert. 1672 erlaubte der Bischof von Rennes den Oratorianern, in ihrer Gemeinschaft liturgisch ein Herz-Jesu-Fest zu feiern. Die im 16. und 17. Jahrhundert vor allem von den Jesuiten und Oratorianern geförderte Herz-Jesu-Verehrung nahm durch die Visionen der Margaretha Maria Alacoque (+1690) neuen Auftrieb: Ihr war Christus erschienen, auf sein Herz deutend, was als sein Verlangen nach der Einführung eines diesbezüglichen Festes verstanden wurde. Das im 18. Jahrhundert in Frankreich, Deutschland und Italien verbreitete Fest wurde 1765 durch Papst Clemens XIII. anerkannt und 1856 unter Papst Pius IX. für die Kirche vorgeschrieben. Papst Leo XIII. erhöhte den Rang des Festes und weihte am 11. Juni 1899 die ganze Welt dem Herzen Jesu. Papst Pius XII. schrieb 1956 über die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu die Enzyklika "Haurietis aquas". Heute ist es ein Hochfest unter dem Namen "Heiligstes Herz Jesu". Gefeiert wird das Herz-Jesu-Fest am Freitag nach der Fronleichnamsoktav, am dritten Freitag nach Pfingsten. Aber auch an jedem ersten Freitag eines Monats werden Herz-Jesu-Tage begangen: Ein - meist abendlicher - Gottesdienst wird als Votivmesse gefeiert. Gebetet wird um Priester- und Ordensnachwuchs.
Herz-Jesu-Theologie
Die Geburt der Kirche aus der Seitenwunde Jesu, geht auf eine alte Herz-Jesu-Theologie aus Kleinasien zurück, die anknüpft an den Ritus des Wasserschöpfens am siebten Tag des Laubhüttenfestes. Die Priester schöpften Wasser aus der Quelle Schiloach und zogen damit siebenmal um den Altar. An diesen Ritus scheint Jesus mit seinem Ruf anzuknüpfen: "Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben; denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war." (Joh 7,37-39) Nach der Lehre erfüllt sich diese Prophetie im Todesleiden des Herrn als seine Verherrlichung.
Hirtenbriefe
In loser Folge wendet sich Bischof Alois Kothgasser in einem Schreiben an die Gläubigen seiner Diözese. Diese "Hirtenbriefe" werden in den Sonntagsgottesdiensten verlesen und liegen in vielen Kirche zur Mitnahme auf. Wir stellen diese Rundschreiben im Internet auch als Download zur Verfügung.

Hochzeit
Die Hochzeit zählt nach wie vor zu den Höhepunkten im Leben vieler Menschen. In der Katholischen Kirche ist die Ehe jenes Sakrament, das sich die Ehepartner gegenseitig spenden. Sie versprechen sich, einander die Treue zu halten und in guten wie in schlechten Zeiten zusammenzustehen. Die Diözese Innsbruck bietet in Seminaren und Vorträgen Hilfestellungen an, um das Leben zu Zweit lebendig zu halten und immer wieder Wege zueinander zu finden.
I
Internationale Arbeit
Ein zentraler Auftrag der Kirche besteht in der weltweiten Solidarität mit den Armen und Unterdrückten. In vielen Ländern der Erde sind diözesane Hilfswerke tätig, um das Gesundheitssystem zu verbesssern, für lebensnotwendiges Wasser zu sorgen oder die sozialen Strukturen zu stärken. Im Mittelpunkt aller Bemühungen steht die Hilfe zur Selbsthilfe.
J
Jugend
"Es gehört eine Menge Mut dazu, jung zu sein." Dieses Zitat von Reinhard Fendrich trifft ins Schwarze. Junge Menschen, die sich heute in der Kirche engagieren und miteinander "junge Kirche" sein wollen, beweisen Mut. Den es braucht Mut, den eigenen Glauben vor Freunden zu leben und zu bekennen. Und es erfordert Mut, in der Kirche aufzutreten und auch Veränderungen einzufordern.
K
Karfreitag
Der Karfreitag zählt zu den wesentlichen Festtagen der Katholischen Kirche. An diesem Tag denken die Gläubigen an den Tod Jesu, der in Jerusalem gekreuzigt wurde.
Das Wort Karfreitag enthält das althochdeutsche Wort "kara", das Trauer oder Klage bedeutet. Die Liturgie des Karfreitag ist geprägt von Trauergesängen, der Kreuzverehrung und den Ostergräbern, die in vielen Kirchen aufgestellt sind. Am Karfreitag wird keine Eucharistie gefeiert, sondern ein Wortgottesdienst. Auch die Glocken werden an diesem Tag nicht geläutet. In manchen Orten ziehen Ministranten oder Jugendliche durch die Straßen, um anstatt der Glocken mit sog. "Ratschen" zur Feier des Gottesdienstes einzuladen.
Da in der Bibel steht, dass Jesus "um die neunte Stunde" am Kreuz gestorben ist, wird der Karfreitagsgottesdienst in der Regel um 15 Uhr gefeiert. (In der Antike begann die Zählung der Stunden eines Tages um sechs Uhr früh.) Einen zentralen Platz in dieser Feier hat das Vorlesen des Berichts des Evangelisten Johannes vom Abschiedsmahl Jesu mit seinen Freunden, von seiner Verhaftung, dem Verhör durch Pilatus und der Kreuzigung (Johannespassion).
Kinder
"Lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich". Wer diesen Satz Jesu ernst nimmt, muss bereits den Kindern als vollwertige Menschen begegnen, ja sich zuweilen an ihrem Vorbild orientieren. Zugleich stellt die Erziehung gerade in der heutigen Gesellschaft eine große Herausforderung dar. Die Kirche will Eltern, Erziehungsberechtigte und Erziehungseinrichtungen in dieser Aufgabe unterstützen.

Kirche
Das hebräische Wort "qahal" entspricht dem griechischen "ekklesía" und bedeutet Aufgebot und Versammlung. "Kirche" leitet sich wohl aus dem griechischen Wort "kyriake" her und meint "dem Herrn zugehörig", also das versammelte Gottesvolk.
Jesus gründet die Kirche
Eine von Jesus gegründete Kirche läßt sich unter anderem festmachen in der Berufung und Unterweisung der zwölf Apostel, in der Mahnung zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes als Vorbereitung für den Eintritt in das kommende Reich und in der Ankündigung eines neuen Tempels. Die Kirche ist ein im Bau befindlicher Tempel, gegründet auf dem Fundament Christi, der Apostel und Propheten.
Jerusalemer Urgemeinde ist die älteste Kirchengemeinde
Die erlebte Wirklichkeit des gegenwärtigen Geistes beim Pfingsterlebnis führt zu freiwilliger Gütergemeinschaft, furchtloser Verkündigung des Wortes Gottes und zu einem Leben in Buße und Reinheit. Neubekehrte werden durch den Taufritus in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen.Innerhalb der Jerusalemer Urgemeinde gibt es zwei Gruppierungen: Die Gruppe um die Zwölf und Jakobus bleibt in enger Beziehung zum Tempel und zur Autorität der Tora. Die Gruppe der Hellenisten um Stephanus nimmt gegenüber diesen Autoritäten eine radikalere Haltung ein und wird in der Folge von der judenchristlichen Gemeinde ausgeschlossen.
Nach Paulus ersetzt die Kirche die Synagoge
Vor dem Hintergrund der israelitisch-jüdischen Volksgemeinde (qahal), der Empfängerin der Abrahamverheißung und des Sinaibundes, betrachtet Paulus die neutestamentliche Kirche als das wahre Israel, mit der wesentlichen Beziehung auf die Person Jesu und den Heiligen Geist. Die Kirche ist eine neue Gemeinde, weil sich ihre Glieder der Gnade Gottes anvertraut haben, der ihnen in Jesus Christus begegnet ist und sie versöhnt hat. Im Denken des Paulus ersetzt die Kirche die Synagoge.
Kirche als Leib Christi
Die Auffassung von der Kirche als Leib Christi meint die Beziehung Christi zur Gemeinde mit der des Hauptes zum übrigen Leib. Der Leib Christi ist ein einheitliches Ganzes, das in jedem seiner Teile präsent ist.
Amtscharakter der Kirche
In der Aufzählung der Gemeindeämter - Presbyter-Bischöfe, Älteste, Diakone, Diakonissen, Witwen - läßt sich die Entwicklung zum Amtscharakter der Kirche des 2. Jahrhunderts klar erkennen.
Katholische Kirche
Die Kirche wird "katholisch" - einzig und weltumfassend - genannt und in platonischen Formen als präexistent beschrieben. Die katholische Kirche ist gültig für alle Zeiten, sorgt für die Liturgie und rechte Weitergabe der apostolischen Tradition.
Kirchenbeitrag
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:

Kirchenmusik
Musik ist ein fester Bestandteil aller Messfeiern und Gottesdienste. Das musikalische Spektrum reicht dabei von der Aufführung bekannter Meister bis hin zum Volksgesang. In den Pfarrgemeinden der Diözese werden vor allem das "Gotteslob" sowie Liederbücher mit neuen geistlichen Liedern ("Das Lob", "David") verwendet. Unzählige Chöre und kleinere Gesangsgruppen leisten einen wesentlichen Beitrag zur feierlichen Gestaltung der Messfeiern in den Gemeinden.

Kirchenzeitung
Die Sonntagszeitung für die Diözese Innsbruck bietet Woche für Woche Informationen aus dem kirchlichen Leben und ist ein wertvoller Begleiter für ein Leben aus dem Glauben.
Kirchliche Pädagogische Hochschule
Die Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein ist eine staatlich anerkannte Einrichtung für die Aus-, Fort- und Weiterbildung für LehrerInnen, ReligionslehrerInnen und Angehörige anderer pädagogischer bzw. sozialer Berufe. Träger der Hochschule sind die Diözesen Innsbruck und Vorarlberg sowie die Erzdiözese Salzburg. Studienstandorte sind Innsbruck und Stams sowie Feldkirch und Salzburg.
Kommunikation
Die Diözese Innsbruck bemüht sich um eine zeitgemässe interne und externe Kommuikation.
Kontemplation
Das Wort Kontemplation ist abgeleitet vom lateinischen contemplari und bedeutet beschauen. In der Spiritualität ist damit ein übergegenständliches Schauen gemeint. Die „Wüstenväter“ und „Wüstenmütter“, Einsiedlerinnen und Mönche der jungen Kirche im vorderen Orient, sprachen vom „Gebet des Geistes“. Dieses Gebet ist losgelöst von mentalen Objekten wie Gedanken, Vorstellungen und Erinnerungen. Der Mensch, der sich der Kontemplation hingibt, verweilt in schweigender Offenheit in der Gegenwart Gottes. Für Thomas von Aquin ist Kontemplation die höchste Form der Erkenntnis. Simone Weil: „Die von jeder Beimischung ganz gereinigte Aufmerksamkeit ist Kontemplation.“
Krankenhaus-Seelsorge
In der Innsbrucker Universitätsklinik und in weiteren Krankenhäusern steht ein ökumenisches Team von haupt- und ehrenamtlich arbeitenden SeelsorgerInnen bereit, das von PatientInnen, Angehörigen und vom Krankenhauspersonal in Anspruch genommen werden kann.
Die SeelsogerInnen sind rund um die Uhr erreichbar und kommen auf Anfrage gerne zu den PatientInnen. Auf Anfrage werden auch SeelsorgerInnen anderer Konfessionen und Religionen vermittelt.
Das Team der Krankenhaus-Seelsorge betreut neben der Universitätsklinik Innsbruck das Landeskrankenhaus Hoch-Zirl, das Landeskrankenhaus Natters, die Pflegeklinik Hall und das Psychiatrische Krankenhaus des Landes Tirol.
Krisensituationen
Die Kirche in Tirol verfügt über eine Reihe von Einrichtungen, die in Krisensituationen oder akuten Notfällen Hilfestellung anbietet. Bitte wenden Sie sich an eine der unten angeführten Einrichtungen.
L
Laienrat
Der Laienrat ist die repräsentative Vertretung der katholischen Laienorganisationen in der Diözese. Er beobachtet die Entwicklungen im gesellschaftlichen (kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen etc.), staatlichen und kirchlichen Leben und vertritt die Anliegen der Katholiken in der Öffentlichkeit.
M
Männer
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:

Mariä Himmelfahrt - Hoher Frauentag
Das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel hat seine Wurzeln im 5. Jahrhundert nach Christus. Im Jahre 1950 Papst Pius XII. die "leibliche Aufnahme Marias in den Himmel" zum Dogma und damit zur verbindlichen Lehre der Kirche erklärt.
Patrozinien, Prozessionen, Kräuterweihe
Von der großen Bedeutung des Marienfestes in Tirol zeugen auch die zahlreichen Patrozinien. In der Diözese Innsbruck sind 24 Pfarrkirchen auf den Titel "Maria Himmelfahrt" geweiht, dazu noch zahlreiche Kapellen. In einigen Gemeinden - so zum Beispiel in Axams, Matrei a. Brenner oder Pfunds, führen am 15. August Prozessionen durch das Dorf. Am Marienfeiertag werden vor allem in ländlichen Gebieten in den Gottesdiensten Kräuter gesegnet. Dieser Brauch besteht seit mehr als 1000 Jahren und wurzelt in einer Marienlegende, wonach die Apostel im Grab der Gottesmutter statt des Leichnams Blumen fanden. Die Kräuter werden für die Zubereitung von Tees, Salben oder zum Kochen verwendet. Bei drohenden Unwettern ist es in vielen Haushalten Brauch, gesegnete Kräuter zu verbrennen.
Landesfeiertag in Tirol
In Tirol erhielt der Marienfeiertag am 15. August eine besondere Bedeutung, als Andreas Hofer Tirol ausdrücklich dem Schutz Marias anvertraute. Im Jahr 1959 hat die Tiroler Landesregierung anlässlich des 150-Jahr-Gedenkens an die Schlacht am Bergisel den Hohen Frauentag zum Landesfeiertag erklärt.
Im Bild ein Detail aus dem Hochaltar der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Schwaz.
Menschen mit Behinderung
Wir in der Kirche müssen eine Atmosphäre schaffen, in der sich auch Menschen mit einer Behinderung „daheim“ fühlen können. Menschen mit einer Behinderung sind eine Bereicherung für unser gesellschaftliches Leben und im Leben der Kirche.
Ministrantinnen und Ministranten
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:
N

Neururer, Otto
Otto Neururer ist ein Martyrer-Priester aus Tirol, der von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen wurde.Otto Neururer wurde am 25. März 1882 in Piller (Pfarre Fließ) geboren. Nach seiner Priesterweihe im Jahre 1907 wirkte er an verschiedenen Tiroler Orten als Kooperator, durch 14 Jahre als Benefiziant an der Propsteikirche St. Jakob in Innsbruck. Im Jahre 1932 wurde er zum Pfarrer in Götzens bestellt und war in dieser Gemeinde ein vorbildlicher Seelsorger. 1938 wurde er von der Gestapo verhaftet, weil er unbeirrt an der Heiligkeit der christlichen Ehe festgehalten hatte. Er wurde zunächst ins KZ Dachau und dann ins KZ Buchenwald gebracht. Unter größter persönlicher Gefahr hat er seinen priesterlichen Dienst auch hier ausgeübt. Als er einem angeblichen Taufbewerber das Sakrament spendete, wurde Neururer in den gefürchteten "Bunker" gesperrt, an den Füßen mit dem Kopf nach unten aufgehängt und so auf grausame Weise zu Tode gequält. Am 30. Mai 1940 wurde sein Tod gemeldet. Die Aschenurne wurde unter großer Anteilnahme des Tiroler Klerus und der Bevölkerung beigesetzt.
Nikolaus
Der hl. NIkolaus zählt wohl zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligenfiguren. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil am Fest des hl. Nikolaus viele Männer und Frauen in die Rolle des Bischofs aus dem vierten Jahrhundert schlüpfen und den Kindern in den Familien kleine Geschenke bringen.
Um den hl. Nikolaus ranken sich wie um jeden Heiligen viele Geschichten und Legenden. Tatsache ist aber, dass er historisch gut bezeugt ist und tatsächlich gelebt hat. Nikolaus war Bischof von Myra in Kleinasien und hat im 4. Jahrhundert gelebt. Er zählt damit zu den ältesten Heiligen, die in der Kirche verehrt werden.
So beliebt der hl. Nikolaus heute in vielen Familien ist, so umstritten ist es, ihn als "Erziehungshilfe" zu missbrauchen. Vor allem die Katholische Jungschar bemüht sich seit Jahren, das Fest des hl. Nikolaus von Drohbotschaften und falsch verstandenen Erziehungsmaßnahmen durch den Nikolo frei zu halten. Jedes Jahr bietet die Jungschar auch Nikolo-Schulungen an, bei denen ein richtiger Umgang mit der Rolle des Nikolaus vermittelt wird.
Aus dem Leben des Heiligen
Der hl. Nikolaus hat schon mit seiner Priesterweihe in jungen Jahren begonnen, sein Vermögen an Arme zu verteilen. Später wurde er zum Bischof geweiht und war einer der Teilnehmer am Konzil von Nizäa im Jahr 325. Schon zu Lebzeiten war Bischof Nikolaus sehr beliebt bei den Menschen, weil er sich stark für die armen und verfolgten Menschen einsetzte. Nikolaus selbst wurde ja als Christ verfolgt und im Gefängnis misshandelt.
Auch wenn über die guten Taten des Nikolaus nicht viele historisch gesicherte Daten vorhanden sind, lässt sich doch aus der rasch nach seinem Tod einsetzenden Legendenbildung darauf schließen, dass der Bischof ein großzügiges Herz hatte. In zahlreichen Erzählungen und Legenden wird berichtet, wie der Bischof armen Menschen mit Geld, Gold oder Lebensmittelspenden geholfen hat.
Parallel zu diesen Legenden entwickelte sich auch ein Erzählstrang, der den Nikolaus als Ermahner und Züchtiger der Kinder und Jugendlichen darstellt. Germanische Mythen, die zur Folge hatten, dass dem Nikolaus im Mittelalter ein Krampus zur Seite gestellt wurden, tun ein übriges, um das Bild des Nikolaus zu verfälschen.
Notburga
Die hl. Notburge zählt zu den bekanntesten Volksheiligen in Tirol. Die Legende weiß zu berichten, daß Notburga um 1265 als Tochter von Hutmachersleuten im Nordtiroler Unterland das Licht der Welt erblickt hat. Mit 18 Jahren kam sie auf Schloß Rottenburg und diente ihrem Herrn, dem Ritter Heinrich und seiner Gemahlin, treu und ergeben. Das ging eine Weile so hin, und alles schien gut zu sein; freilich begann die Schloßherrin schon recht bald, einen schiefen Blick auf ihre Dienstmagd zu werfen. Notburga konnte nämlich die Not der Armen nicht teilnahmslos mit ansehen und reichte ihnen Brot und Wein vor das Schloß hinaus. Sie tat es in aller Heimlichkeit und wurde einmal dabei von ihrer geizigen Herrin überrascht. Als sie wahrheitsgemäß antwortete, und die stolze Schloßherrin sich der Gaben bemächtigen wollte, hatte sich das Brot in Hobelspäne und der Wein in Lauge verwandelt. Notburga wurde aus dem Dienst gejagt, sie ging über das Tal nach Eben und verdingte sich dort bei einem Bauern. Als der Bauer einmal von ihr und den anderen Dienstleuten verlangte, sie sollten noch am Samstag nach dem Feierabendläuten den Weizen schneiden, da warf sie die Sichel in die Luft, und diese blieb an einem Sonnenstrahl am Himmel hängen.Über Schloß Rottenstein kam in der Zwischenzeit Unglück, die Schloßherrin starb, und Ritter Heinrich suchte Notburga auf und bat sie, zurückzukehren. Sie kehrte auf Rottenburg zurück und durfte jetzt offen mildtätig gegenüber den Armen sein. Sie lebte noch viele Jahre. Als sie gestorben war, begrub man sie in Eben. Ihre Verehrung hat sich nicht nur in Tirol erhalten, sondern auch in Bayern, Slovenien, Kroatien und Istrien. Diese Tiroler Heilige ist ein lebendiges Zeichen für das Recht der Menschen auf Ruhe nach der Arbeit, auch ist sie ein Vorbild der sozialen Caritas.
Ganz im Sinne der hl. Notburga im Dienst am Nächsten ausgerichtet ist die Notburga-Gemeinschaft der Diözese Innsbruck. ihr Sitz ist in Maurach am Achensee. Diese Gemeinschaft von Frauen widmet sich vor allem dem täglichen Gebet und kümmert sich um kranke und alte Menschen.
Notburgagemeinschaft
Die Notburgagemeinschaft ist eine Vereinigung von Frauen zur Förderung der Diakonie. Die heilige Notburga ist uns Vorbild. An ihr wird deutlich, dass Nächstenliebe Gottesliebe ist.
O
Orgelkommission
Die Orgelkommission steht allen Pfarren der Diözese bei Orgelneubauten, Orgelumbauten, Revisionen, Restaurierungen, Renovierungen und Rekonstruktionen beratend und unentgeltlich zur Verfügung.
Ostern - Ostersonntag
Das Osterfest ist das höchste und zugleich älteste Fest der Katholischen Kirche. Dieser Festtag erinnert an die Auferstehung Jesu, wie sie in den Evangelien berichtet wird. Das Osterfest wird traditionell am ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn gefeiert. Es zählt somit zu den "beweglichen Feiertagen". Der früheste Ostertermin ist der 22. März, der späteste der 25. April. Am jeweiligen Datum des Osterfestes orientieren sich auch eine Vielzahl anderer Feiertage: Christi Himmelfahrt (40 Tage nach Ostern), Pfingsten (50 Tage nach Ostern) und Fronleichnam (61 Tage nach Ostern).
Die zentrale Botschaft des Osterfestes wird im Evangelium deutlich, das an diesem Festtag verlesen wird: (Markus 16, 1-7). Die Stelle findet sich ähnlich auch beim Evangelisten Lukas (Lk 24, 1-12) und Matthäus (Mt 28, 1-10).
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.
Vorbild des christlichen Osterfestes ist das jüdische Pessach-Fest. An diesem wird der Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei Ägyptens gefeiert. Die Juden zur Zeit Jesu aßen am Abend vor diesem Fest im Familienkreis ein Lamm. Da Jesus in zeitlicher Nähe zu diesem jüdischen Fest hingerichtet worden ist und "am dritten Tag" danach, an einem Sonntag, von den Toten auferstanden ist, sahen die Christen in ihm das "wahre Osterlamm", das sogar der Sklaverei des Todes ein Ende setzen kann.
Die Liturgie der Osternacht besteht aus vier Teilen: der Lichtfeier mit der Segnung und Entzündung der Osterkerze, der Wortgottesfeier mit der Verlesung von zentralen Texten der Bibel, die Tauffeier mit der Erneuerung des Taufversprechens und schließlich der Eucharisitiefeier. In der Osternacht wird auch das Taufwasser für die Taufen des kommenden Jahres geweiht.
P
Pädagogische Hochschule
Die Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein ist eine staatlich anerkannte Einrichtung für die Aus-, Fort- und Weiterbildung für LehrerInnen, ReligionslehrerInnen und Angehörige anderer pädagogischer bzw. sozialer Berufe. Träger der Hochschule sind die Diözesen Innsbruck und Vorarlberg sowie die Erzdiözese Salzburg. Studienstandorte sind Innsbruck und Stams sowie Feldkirch und Salzburg.
Palmsonntag
Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, die mit dem höchsten Festtag der Katholischen Kirche, dem Osterfest, ihren Abschluss findet. In der Karwoche wird der letzten Lebenstage Jesu gedacht, beginnend von seinem Einzug in Jerusalem, an dem nach biblischem Bericht die Menschen Palmzweige auf den Weg legten und Jesus unter dem Jubel der Menschen auf einem Esel in die Stadt eingezogen ist.
Am Palmsonntag beherrschen in vielen Gottesdiensten die langen Palmlatten der Burschen das Bild. Viele Gläubige bringen auch Ölzweige mit, die im Gottesdienst gesegnet werden. Die Zweige erinnern an den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem.
PastoralassistentInnen
Pfarrgemeinden
Die Pfarrgemeinde (Pfarre) ist die kleinste Seelsorgeseinheit in einer Diözese. Sie wird in der Regel von einem Priester oder von einem Kurator (ohne Priesterweihe) geleitet. Die Pfarrgemeinde ist der zentrale Ort des christlichen Lebens, der Verkündigung und der Feier von Gottesdiensten. In der überwiegenden Zahl der Pfarrgemeinden wird das pfarrliche Leben vom Priester oder Kurator in Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat gestaltet. Für die Verwaltung des pfarrlichen Vermögens ist der Pfarrkirchenrat zuständig.
In der Diözese gibt es ca. 246 Pfarrgemeinden und 36 Seelsorgsstellen.
Zu den Pfarrgemeinden der Diözese Innsbruck, die im Internet vertreten sind, finden Sie über die Linkliste (rechts).
Pfarrgemeinderat
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:

Pfingsten
Pfingsten: Hoffnung wider allem Chaos
50 Tage nach Ostern feiern die Christen am Pfingstsonntag, 27. Mai, das Fest des Heiligen Geistes. Das Wort Pfingsten leitet sich ab von "Pentekoste", dem griechischen Begriff für "fünfzig". Die Bibel versteht den Heiligen Geist als schöpferische Macht allen Lebens. Er ist nach kirchlicher Lehre in die Welt gesandt, um Person, Wort und Werk Jesu Christi lebendig zu erhalten. Die Apostelgeschichte berichtet, wie die Jünger Jesu durch das Pfingstwunder "mit Heiligem Geist erfüllt wurden und begannen, mit anderen Zungen zu reden". Das so genannte Sprachenwunder will darauf hinweisen, dass die Verkündigung der Botschaft von Jesus Christus sprachübergreifende Bedeutung für die ganze Welt hat. Aus der so genannten „Jesusbewegung“ - Maria und die Jünger, die sich in Jerusalem versammelt hatten - entwickelte sich die Kirche.
Darstellung des Heiligen Geistes
Die Herabkunft des Heiligen Geistes wird oft mit Feuerflämmchen dargestellt. Ein anderes Symbol ist die Taube. Im späten Mittelalter wurde der Heilige Geist auch in menschlicher Gestalt dargestellt, obwohl Papst Urban VIII. und Papst Benedikt XIV. vor diesem Bildtypus warnten.
Seit alter Zeit werden in der Kirche sieben Gaben des Heiligen Geistes genannt, an denen das Wirken des Geistes im Menschen besonders spürbar ist: Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht d.h. Respekt und Achtung vor Gott.
„Der Geist macht lebendig“ ist der Wahlspruch Bischof Scheuers
Der Geist Gottes ist keine „Erfindung“ der Christen. Schon im Alten Testament wird der Geist Gottes als Ursprung des Lebens betrachtet. Am Beginn der Schöpfung heißt es: „Der Geist Gottes schwebte über den Wassern“.„Der Geist macht lebendig“, so lautet der Leitspruch von Diözesanbischof Manfred Scheuer, den er bei seinem Amtsantritt im Dezember 2003 gewählt hat. Scheuer vertraut darauf, dass „Gottes Geist eine kraftgeladene Wirklichkeit von höchster Lebendigkeit und Bewegtheit ist. Er bewirkt, dass man sich nicht mit nostalgischer Wehmut nur der Vergangenheit erinnert und es damit bewenden lässt, sondern dass die einmal geweckten Kräfte wach bleiben, fruchtbar werden und zu neuen Impulsen führen.“
Das Bild zeigt ein Glasfenster der Tiroler Künstlerin Cryseldis in der Hl. Geist-Kirche in Telfs-Schlichtling.
Pilgern
Ob es der Besuch eines nahegelegenen Wallfahrtsortes ist oder eine Wanderung entlang des Jakobsweges - Pilgern erfreut sich einer großen Beliebtheit. Die Tradition der christlichen Wallfahrt reicht zurück bis in die ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt. Auf Wallfahrten bitten die Pilger um Hilfe in Not und um Heilung von Krankheit. Wallfahrten können aber auch Ausdruck von Dank für erlange Hilfe sein.
In der Diözese Innsbruck bietet die Kirchenzeitung "Tiroler Sonntag" Pilgerreisen sowie Kultur- und Wanderreisen an.
Priester
Priester werden vom Bischof geweiht und erhalten dadurch die Vollmacht, die Eucharistie (Heilige Messe) zu feiern und das Sakrament der Beichte zu spenden. Zu den drei wesentlichen Aufgaben eines Priesters zählt die Verkündigung der Frohen Botschaft (Evangelium), die Feier des Gottesdienstes und die Sorge um die Nöte und Anliegen der Menschen. In der Katholischen Kirche können nur Männer die Priesterweihe empfangen. Vom Priesteramt unterschieden ist das sog. "allgemeine Priestertum", zu dem alle gläubigen Christen aufgrund ihrer Taufe berufen sind.
In der Diözese sind etwa 150 Priester in der Seelsorge tätig, dazu ca. 60 Priester aus Ordensgemeinschaften.
Priesterseminar
Die Diözese Innsbruck und die Diözese Feldkirch führen gemeinsam in Innsbruck ein Priesterseminar. In diesem Haus bereiten sich junge Männer auf den Priesterberuf vor.
R
Rorate
Die Rorate-Messe war bis zur liturgischen Erneuerung nach dem 2. Vatikanischen Konzil eine Votivmesse zu Ehren Marias, die ursprünglich nur an den Samstagen der Adventszeit, mancherorts aber auch täglich gefeiert wurde. Dabei wurden immer die gleichen Texte verwendet. So begann diese Messe immer mit dem Eröffnungsvers: "Rorate coeli desuper..." - "Tauet, Himmel, von oben..." Die Farbe der Gewänder war immer weiß; oft wurden als Beleuchtung nur Kerzen verwendet und am Schluss wurde der sakramentale Segen erteilt. Durch die liturgische Erneuerung wurde der Akzent stärker auf die Erwartung des Herrn gelegt und die einzelnen Tage erhielten je ein komplettes Mess-Formular mit eigenen Gebeten und Schriftlesungen. Manche Gemeinden greifen inzwischen zur Gestaltung der Messe - oder auch von Wort Gottes-Feiern - an den Werktagen des Advent in der Weise auf das Rorate zurück, dass die Feier ausschließlich bei Kerzenlicht stattfindet und jeweils am Ende ein Marienlied gesungen wird. Auch kann der alte Eröffnungsvers gleichsam als Signal jeweils gesungen werden. Wenn sich eine entsprechende Gruppe von Sängerinnen und Sängern findet, kann in Messfeiern auch, nach altem Brauch, jeweils die Choralmesse "Missa de Angelis" (GL 405-409) gesungen werden.
aus: "praxis gottesdienst" November 2002
S
Sakramente
Ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen für die (unsichtbare) Gnade und Liebe Gottes. (Lateinisch "sacramentum" bedeutet: ein religiöses Geheimnis, etwas Vertrautes, das uns "unsagbar" angeht.
Im ursprünglichen Sinne ist Jesus Christus selbst "Sakrament": in ihm ist Gottes Liebe in Wort und Tat unter den Menschen erschienen. In ähnlichem Sinne ist die Kirche Sakrament, d.h. ein wirksames Zeichen der Menschenliebe Gottes, die sie verkündet und wirksam werden lässt. Die Kirche kennt sieben Sakramente (Taufe, Firmung,Kommunion, Buße, Priesterweihe, Ehe, Krankensalbung), in denen Gottes Wirken zeichenhaft sichtbar wird. In den Sakramenten wird uns in unterschiedlichen Lebenssituationen sichtbar und hörbar die befreiende Nähe Gotteszugesagt; im gläubigen Empfang der Sakramente geben wir Gott Raum in unserem Leben.
Schule
Die Diözese Innsbruck und viele Ordensgemeinschaften auf dem Gebiet der Diözese Innsbruck führen Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte, und Schulen. Ihnen allen gemeinsam ist das Ziel, Kinder und junge Menschen auf dem Hintergrund eines christlichen Weltbildes zu erziehen und auszubilden.
Die Diözese Innsbruck führt in Schwaz ein Bischöfliches Gymnasium und in Stams das Institut für Sozialpädagogik. Eine Stiftung der Diözese Innsbruck ist die „Kirchlich Pädagogische Hochschule Edith Stein“, in die die Diözesen Innsbruck und Feldkirch sowie die Erzdiözese Salzburg ihre Pädagogische Akademie, ihre Religionspädagogischen Akademien sowie ihre Religionspädagogischen Institute eingebracht haben..
Zur Homepage des Bischöflichen Schulamtes
Weitere Einrichtungen, die Materialien oder Initiativen im Schulbereich anbieten:
Schutz ungeborenen Lebens
Der technische Fortschritt und die Möglichkeiten der modernen Biomedizin werfen viele ethische und religiöse Fragen auf. Dazu zählt vor allem auch die Frage, wann das menschliche Leben beginnt. Nach den Erkenntnissen der medizinischen Forschung steht fest, dass dies mit der Befruchtung der weiblichen Eizelle geschieht. Zu diesem Zeitpunkt sind sämtliche Anlagen des späteren Menschen bereits angelegt. Daraus ergibt sich die moralische Verpflichtung, für den Schutz dieses Lebens einzutreten. Dies gilt besonders für die Versuche der Biomedizin, Embyronen für Forschungszwecke zu missbrauchen.
Schwerhörig
Wie kann man Schwerhörigen in der Kirche entgegenkommen?
Lesen sie mehr dazu auf dieser Seite: Schwerhörigenseelsorge
Seelsorgeraum
In einem Seelsorgeraum sind mehrere rechtlich selbständige Pfarren miteinander verbunden. Sie beschreiten einen gemeinsamen pastoralen Weg, indem sie ihre Angebote koordinieren und gemeinsame Schwerpunkte setzen.
Weitere Informationen zu den Seelsorgeräumen in der Diözese Innsbruck
Sekten
Mit dem Wort "Sekte" werden im religiösen Zusammenhang Gruppen bezeichnet, die in einer strittigen Beziehung zu ihrer Herkunftsreligion stehen. Impersönlichen Bereich kann dies zu Konflikterfahrungen führen, dieHilfesuchende zu Anfragen oder zur Ratsuche veranlasst. Beratungsgespräche können helfen, Erfahrungen zu verarbeiten und die eigene Position zu klären.
Sexualität
Sie ist allgegenwärtig: in der Werbung, am Stammtisch, in Schlagertexten, in der Phantasie und den Träumen der Menschen. Sie ist ein Geschenk Gottes. Sexualität kann Ausdruck tiefer Liebe und Wertschätzung sein. Wir müssen achtsam, behutsam und verantwortungsbewußt damit umgehen. Sexualität und Erotik haben auch in der Bibel einen großen Stellenwert. Das "Hohelied der Liebe" im Alten Testament wird von vielen als einer der schönsten und tiefsten erotischen Texte der Weltliteratur angesehen.
Sonntagsruhe
Die Diözese Innsbruck setzt sich seit vielen Jahren für die Bewahrung der Sonntagsruhe und des arbeitsfreien Sonn- und Feiertages ein. Die "Allianz für den freien Sonn- und Feiertag" - ein österreichweiter Zusammenschluss von kirchlichen und nichtkirchlichen Organisationen - bemüht sich um Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung und bei den politisch Verantwortlichen.
Sozialwort
Das Projekt Sozialwort ist eine Initiative der 14 christlichen Kirchen in Österreich. Gemeinsam wollen diese zu gesellschaftlichen Herausforderungen Stellung nehmen. Damit möchten die Kirchen ihre gesellschaftspolitische Verantwortung wahrnehmen.
Ausgangspunkt dafür bildete eine breite Erhebung der sozialen Praxis der Kirchen. Die Ergebnisse dieser Erhebung, der Standortbestimmung, wurden in einem Sozialbericht präsentiert. Auf dieser Grundlage wurde das Sozialwort des ökumenischen Rates der christlichen Kirchen in Österreich erarbeitet und im Jahr 2003 in Buchform veröffentlicht. Großer Wert wurde bei diesem Prozess auf eine möglichst breite Beteiligung von kirchlichen Einrichtungen, Initiativen, Gruppen und Gemeinden gelegt, die sich im sozialen und sozialpolitischen Bereich engagieren.
Das Sozialwort soll als Grundlage für Diskussionen und Veranstaltungen dienen und zur Weiterarbeit anregen
Den gesamten Text des Sozialworts sowie eine interaktive Web-Learning-Version zum Sozialwort finden Sie unter
Spiele
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:
Spiritualität
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:
Spirituelle Begleitung
Spirituelle Begleitung geht von der Annahme aus, dass jeder Mensch ein „Ebenbild Gottes“ ist und sich in jedem Menschen das Bild Gottes auf einmalig unverwechselbare Weise ausprägt.
Die Spirituelle Begleitung ist eine Hilfe, sich der inneren göttlichen Präsenz bewußt und für sie transparent zu werden, die persönliche Berufung zu entdecken und die eigenen Charismen zu entfalten.
In der Spirituellen Begleitung geht es um einen intensiven seelsorglichen Prozess in Form von Einzelgesprächen, die in regelmäßigen Abständen, über einen längeren Zeitraum und gebunden an die Schweigepflicht stattfinden. Am Beginn steht eine Vereinbarung bezüglich Dauer und Abstände der Gespräche. Die Spirituelle Begleitung kann je nach Situation zwischen einigen Monaten und Jahren dauern.
Sportliche Betätigung
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:
Sternsinger
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:
T
Taubstummenseelsorge
Das Wort "taubstumm" wurde früher verwendet, doch mittlerweile wird es als Diskriminierung empfunden. Erstens sind Gehörlose nicht sprachlos (stumm = sprachlos), denn sie haben die Gebärdensprache. Zweitens wird der Begriff "taubstumm" mit der früheren gesellschaftspolitischen Stellung der "Taubstummen" verbunden, die sie selbst als diskriminierend erlebt haben. Gehörlose bezeichnen sich nie als "taubstumm" und möchten auch nicht so bezeichnet werden.
Auch der Begriff "Taubstummenseelsorge" gehört daher der Vergangenheit an. Seit den 70er-Jahren spricht man von der "Gehörlosenseelsorge". Sie ist eine "Seelsorge in Gebärdensprache". Schon der heilige Augustinus hat geschrieben: "Wenn man sich die Mühe machen würde, die Gebärdensprache der tauben Menschen zu erlernen, dann müsste es doch möglich sein, auch ihnen die Botschaft Christi zu verkünden."
Hier geht es zur Gehörlosenseelsorge

Taufe
Die Taufe ist eines der sieben Sakramente der Katholischen Kirche. Durch sie wird ein Mensch in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen. Ihre Wurzeln hat die christliche Taufe in den biblischen Erzählungen von der Taufe des Johannes und der Taufe Jesu. Jesus selbst gibt seinen Freunden den Auftrag: „Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes...“

Telefonseelsorge
Probleme in der Partnerschaft, Einsamkeit, Trauer, Verzweiflung - die Gründe sind vielfältig, warum sich Menschen an die Telefonseelsorge wenden. In den Gesprächen können Probleme und Fragen oft in einem Licht gesehen werden. Reden hilft, Erlebtes zu verarbeiten und die eigenen Situation bewusster wahr zu nehmen.
Online-Beratung:
www.onlineberatung-telefonseelsorge.at
Theologie studieren
In Innsbruck bietet die Theologische Fakultät der Universität Innsbruck die Möglichkeit, Theologie zu studieren. Begleitet und auf mögliche spätere Berufsfelder vorbereitet werden die Theologiestudenten vom Ausbildungszentrum für Theologiestudierende.
Zur Homepage der Theologischen Fakultät
Tourismus
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:
Trauer
Auf folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Ihrem Stichwort:
W
Wallfahrten
Wallfahren erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die Tradition der christlichen Wallfahrt reicht zurück bis in die ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt. Auf Wallfahrten bitten die Pilger um Hilfe in Not und um Heilung von Krankheit. Wallfahrten sind auch Ausdruck von Dank für erfahrene Hilfe in Krankheit oder Not.
Bekannte Wallfahrtsorte in der Diözese Innsbruck sind Maria Locherboden bei Mötz, St. Georgenberg in Fiecht, Maria Waldrast bei Matrei a. Brenner und Kaltenbrunn bei Prutz. Bekannte Wallfahrtsorte in Osttirol sind Hollbruck und Lavant.
Weg der Achtsamkeit
Achtsamkeit bedeutet, den Augenblick wach zu erleben, die Gegenwart bewußt wahrzunehmen, offen zu sein für die Fülle der ganzen Wirklichkeit. Die Praxis der Achtsamkeit führt dazu, sich selbst besser kennen und annehmen zu lernen. Achtsamkeit gewährt einen barmherzigen und gütigen Blick auf die innere und äußere Realität. Sie ist die Quelle des Staunens und der Ehrfurcht vor dem unergründlichen Geheimnis hinter allem Sein.
Eine Kultur der Achtsamkeit bedarf der Übung – in der Lebensführung des Alltags und im regelmäßigen schweigenden Dasein der Kontemplation. Wach werden ist ein Weg.
Das Referat für Spirituelle Begleitung hilft und begleitet bei der Einübung des Weges der Achtsamkeit.

Weihnachten
Zu Weihnachten feiert die Katholische Kirche die Geburt von Jesus Christus, der nach den Berichten der Evangelisten in einem Stall in Bethlehem zur Welt gekommen ist. Das Weihnachtsfest wird am 25. Dezember gefeiert, am Vorabend (Heiliger Abend) wird in den sog. "Christmetten" das Ereignis der Geburt Jesu gefeiert.
Das Weihnachtsfest wird seit dem 4. Jahrhundert am 25. Dezember gefeiert. Dieser Termin steht in Zusammenhang mit dem römischen Fest der „Natalis solis invicti“, der Geburt der unbesiegbaren Sonne. Dieses römische Fest der Wintersonnenwende wurde von den frühen Christen auf Christus als der „Sonne der Gerechtigkeit“ umgedeutet. Es ist also kein Zufall, dass Weihnachten dann gefeiert wird, wenn die Tage wieder länger werden. Wann genau Jesus wirklich auf die Welt gekommen ist, lässt sich historisch nicht klären.
Christbaum und Geschenke
Das weit verbreitete Schmücken eines Nadelbaumes zu Weihnachten (Christbaum) geht zurück auf die Symbolik des Lichts, die schon in den Weihnachtspredigten von Papst Leo dem Großen (+461) vorkommt: Christus wird seither mit dem Licht oder der Sonne verglichen. Geschichtlich nachweisbar ist der Christbaum seit dem 16. Jahrhundert.
Dass die Menschen einander zu Weihnachten beschenken, war nicht immer so. Noch im Mittelalter wurden die Kinder zum Fest des hl. Nikolaus (6. Dezember) beschenkt. Später wurde dieser Brauch dann auf das Weihnachtsfest verlegt. Obwohl der Brauch des Schenkens nicht unmittelbar mit dem Fest der Geburt Jesu zu tun hat, wird er in christlichen Familien doch als Sinnbild dafür gesehen, dass Jesus Christus der Welt als Erlöser geschenkt wurde
Das Weihnachtsevangelium, wie es am Heiligen Abend in den Gottesdiensten zu hören ist:
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum erstenmal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. (Lukas 2)
Hintergrund zum Weihnachtstermin:
Das genaue Datum der Geburt Jesu ist unbekannt. Auf Grund unterschiedlicher Traditionen feiern Christen verschiedener Kirchen an verschiedenen Terminen. Katholiken, Protestanten und ein Teil der Orthodoxie begehen Weihnachten am 25. Dezember nach dem Gregorianischen Kalender; während sich ein anderer Teil der Orthodoxie für den 25. Dezember nach dem Julianischen Kalender entschieden hat. Das entspricht dem 6. Januar nach dem Gregorianischen Kalender.
Der 25. Dezember als Weihnachtsdatum ist erstmals für Rom im Jahr 336 gesichert; dabei wurde zunächst gleichzeitig das Fest der Anbetung der Weisen begangen, das später auf den 6. Januar verlegt wurde. Einige Historiker gehen davon aus, die Kirche habe den Termin bewusst gewählt, um das von den römischen Kaisern 274 eingeführte heidnische «Geburtsfest des unbesiegbaren Sonnengottes» neu zu deuten. Dagegen glauben Vertreter einer «Berechnungshypothese», der Termin sei vom 25. März her errechnet worden, der nach der Tradition als Tag der Empfängnis Jesu galt.
Der Julianische Kalender gilt für die Kirchen von Jerusalem, Russland, Serbien, Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Georgien und der Ukraine sowie für die koptische, äthiopische und die armenische orthodoxe Kirche. Die orthodoxen Kirchen von Konstantinopel, Alexandrien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland und die syrisch-orthodoxe Kirche orientieren sich dagegen am Gregorianischen Kalender. Die meisten der in Deutschland lebenden orthodoxen Christen, darunter etwa 400.000 Griechen, feiern also auch am 25. Dezember.
Der 6. Januar als Gedenktag der Geburt Jesu und der Anbetung der Weisen ist erstmals für das Jahr 361 aus Paris und für das Jahr 426 aus der orientalischen Kirche überliefert. Verschiedentlich wurde zugleich die Taufe Jesu im Jordan begangen. Ursprung dieses Termins dürfte nach Meinung der Wissenschaftler ein heidnischer Feiertag sein, nämlich die in Alexandrien begangene Geburt des Gottes Aion von einer Jungfrau. Aion verkörperte die Vorstellungen von Zeit und Ewigkeit.

Weltanschauungsfragen
Eine Weltanschauung entwirft einen ganzheitlichen Sinnhorizont, um Alltagserfahrungen bewerten und Lebensentscheidungen begründen zu können. In einer sich stark individualisierenden Gesellschaft lösen sich kulturelle und religiöse Gemeinsamkeiten auf, aber die Fragen bleiben: Wie sind die Welt und das eigene Leben zu deuten? Die heutige Vielfalt von Weltanschauungen geht auf die modernen Emanzipationsbewegungen und die zunehmende multikulturelle Auffächerung der Existenzdeutungen zurück. Die Unterschiede zwischen einer religiösen und agnostischen, bzw. zwischen einer wertorientierten und esoterischen Lebenseinstellung werden oft erst im Alltag bewusst und fordern zum Mitdenken und Mitreden heraus.
Wiedereintritt in die Katholische Kirche
Sie sind getauft, aber zu einem späteren Zeitpunkt aus der Katholischen Kirche ausgetreten? Die Gründe dafür haben Sie vielleicht niemals geäußert. Manchmal dient der Kirchenbeitrag als Anlass, oder es sind bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse mit VertreterInnen der Kirche, Aussagen oder Entscheidungen, die Sie nicht akzeptieren konnten,...
Was auch immer die Gründe gewesen sein mögen, die Türen der Kirche stehen weiterhin offen für Sie und Sie haben jederzeit die Möglichkeit, in die Gemeinschaft der Kirche zurückzukehren.
Sie können sich an den Seelsorger ihres Ortes wenden. Auch die Diözese Innsbruck bietet Ihnen dafür Kontaktpersonen an: