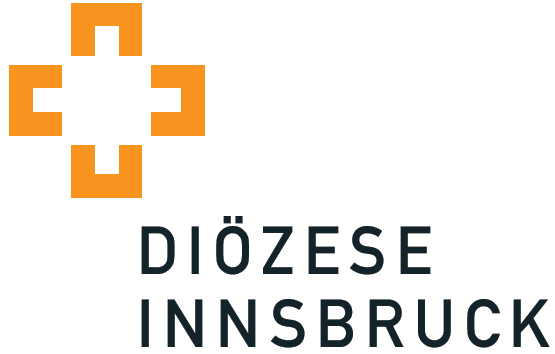Kirchliche Schöpfungszeit: Verantwortung für die Umwelt
Im Zentrum steht die gemeinsame Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft, inspiriert von der Enzyklika Laudato si von Papst Franziskus. Das Lehrschreiben, das vor zehn Jahren veröffentlicht wurde, fordert eine „ökologische Umkehr“ und eine neue Lebensweise, die über technische Lösungen hinausgeht und auf innerer Umkehr basiert.
Der ökumenische Schöpfungstag am 1. September ist seit 2015 auch im katholischen Kalender verankert. Die Initiative geht auf den orthodoxen Patriarchen Dimitrios I. zurück und wurde später von evangelischen und katholischen Kirchen übernommen. Die Schöpfungszeit ist Ausdruck eines breiten kirchlichen Engagements für Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit.
Papst Leo XIV.: Umweltgerechtigkeit ist Glaubensfrage
Zum Gebetstag für die Bewahrung der Schöpfung am 1. September ruft Papst Leo XIV. zu entschlossenem Handeln gegen Umweltzerstörung auf. In seiner Botschaft warnt er: „Unsere Erde ist im Verfall.“ Die Folgen des Klimawandels, der Entwaldung und Umweltverschmutzung träfen vor allem die Schwächsten – etwa indigene Gemeinschaften. Umweltgerechtigkeit sei daher keine abstrakte Idee, sondern eine dringende soziale, wirtschaftliche und menschliche Notwendigkeit.
Der Papst betont, dass die Bewahrung der Schöpfung eine Frage des Glaubens sei. Ohne spirituelle Rückbindung drohe Umweltengagement zur Ersatzreligion zu werden. Das diesjährige Motto „Samen des Friedens und der Hoffnung“ lädt dazu ein, sich für eine ganzheitliche Ökologie zu entscheiden – im Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und die Zukunft unseres Planeten.
Kirche seit zehn Jahren auf Klimaschutzkurs
Seit der Veröffentlichung der Enzyklika Laudato si’ im Jahr 2015 verfolgt die Katholische Kirche in Österreich konsequent einen Kurs in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Bischof Alois Schwarz, Umweltbeauftragter der Bischofskonferenz, betont in einem Beitrag für „Gesellschaft & Politik“, dass seither zahlreiche Initiativen auf Österreich- und Diözesanebene zur „Ökologisierung“ der Kirche beigetragen haben.
Dazu zählen verbindliche Nachhaltigkeits-Leitlinien, eine Klimastrategie mit dem Ziel der Klimaneutralität, eine ökologische Beschaffungsordnung sowie der Ausstieg aus fossilen Investments. Ein Arbeitskreis der Bischofskonferenz begleitet diese Prozesse und erhebt Daten etwa zum Energiebedarf kirchlicher Gebäude.
Auch Projekte wie der Umweltpreis, „Autofasten“ oder die „Schöpfungszeit“ fördern das Bewusstsein für eine nachhaltige Lebensweise. Ziel ist eine CO₂-Reduktion um 60 % bis 2030. Schwarz betont, dass all diese Maßnahmen in einer „ökologischen Spiritualität“ verankert sein müssen – als Ausdruck der Verantwortung gegenüber dem Schöpfer und der Schöpfung.
Zum Start der Schöpfungszeit rufen auch die katholischen und evangelischen Umweltbeauftragten Österreichs zu mehr konkretem Handeln auf. Das neue Online-Portal www.schoepfung.at bietet zahlreiche „Good practise“-Beispiele, etwa zu nachhaltigem Bauen, Energieeinsparung oder Mobilität. Auch der kirchliche Umweltpreis 2025 wurde ausgeschrieben. (Infos: www. schoepfung. at/umweltpreis).
Eine Aktion der Evangelischen Kirche soll zum größten Balkonkraftwerk Österreichs führen. Ethiker Markus Gerhartinger: „Es ist Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen.“
Gemeinsam unterwegs: Ökumenische Wanderung zum Höttinger Bild
Am Samstag, 27. September 2025, lädt die Initiative Ökumene Tirol gemeinsam mit dem Haus der Begegnung zur ökumenischen Wanderung zum Höttinger Bild ein – ein Angebot, um Gemeinschaft zu erleben, sich an der Natur zu freuen und zur Ruhe zu kommen.
Zwei Wanderoptionen stehen zur Auswahl:
- Ab 14.00 Uhr von der Hungerburg (Gehzeit ca. 2 Stunden)
- Ab 15.00 Uhr vom Planötzenhof (Gehzeit ca. 50 Minuten)
Um 16.00 Uhr feiern wir gemeinsam eine ökumenische Andacht mit Pfarrer Bernhard Kranebitter beim Höttinger Bild – ein Moment des Innehaltens und der Besinnung auf die Schöpfung.
Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein im Planötzenhof. Anmeldung bitte unter: initiative@oekumene-tirol.at
Die Andacht findet bei jeder Wetterlage statt. Herzliche Einladung!
Vatikan eröffnet Nachhaltigkeitszentrum
Das erste eigene Vatikanrestaurant, ein für jedermann geöffnetes Hotel auf päpstlichem Gelände, Wein aus eigenem Anbau - die Pläne für das "Borgo Laudato si", das am Freitag von Papst Leo XIV. gesegnet wird, sind groß. Bislang steht in den Gärten der päpstlichen Sommerresidenz in Castel Gandolfo aber lediglich ein großes gläsernes Gewächshaus, das mit seiner runden Form an die Kolonnaden des Petersplatzes erinnern soll. In den zwei länglichen Gebäuden dahinter sind Kurse in Umweltbildung für Schulkinder, Studenten und Manager geplant.
Vor zehn Jahren verfasste Papst Franziskus (2013-2025) seine berühmte Enzyklika "Laudato si". Darin warb er für einen besseren Umgang mit der Umwelt und der Menschen untereinander. Das "Borgo Laudato si" soll das Umwelt- und Sozialschreiben nach seinem Wunsch in die Praxis umsetzen. Neben dem Umweltschutzaspekt werden darum auch gezielt benachteiligte Personen gefördert, beispielsweise Migranten oder Betroffene häuslicher Gewalt.
Sie werden auf dem rund 55 Hektar großen Gelände in Gärtnerarbeiten und Grünflächenpflege ausgebildet und anschließend bei ihrer Eingliederung in den Arbeitsmarkt begleitet. Laut Kardinal Fabio Baggio, Generaldirektor des Bildungszentrums "Laudato si", konnte nach dem diesjährigen Kurs bereits rund ein Dutzend Personen eine Arbeitsstelle vermittelt werden. Künftig sollen die Arbeitskurse auf den Sektor der regenerativen Landwirtschaft ausgeweitet werden, Ausbildungen im noch entstehenden Restaurant und in der Weinproduktion sind ebenfalls angedacht.
Wein und Olivenöl
Die erste Lese in den päpstlichen Weinbergen soll im Jahr 2027 stattfinden. Der erste Wein aus den fünf Rebsorten kann im darauffolgenden Jahr getrunken werden. Der Name steht schon fest: "Laudato si". Bereits als Öl abgefüllt ist die diesjährige Olivenernte - 3.000 Liter sind es laut Baggio. In Zusammenarbeit mit lokalen Landwirten soll die Weiterverarbeitung von Milch beispielsweise zu Speiseeis wieder aufgenommen werden, der Bauernhof der päpstlichen Residenz mit eigenen Kühen besteht nicht mehr. Ebenso investiert der Vatikan in die Produktion von Honig sowie von Tees und ätherischen Ölen aus den Pflanzen der päpstlichen Gärten.
All diese Produkte sollen in den Einrichtungen auf dem Gelände genutzt wie weiterverkauft werden. Der Erlös fließt zurück in die Aus- und Weiterbildungsprojekte des Borgos. Der Vatikan trägt dabei die Kosten für seine eigenen Mitarbeiter und die Berufskurse, die auch von der örtlichen Caritas unterstützt werden. Die Kosten für die "Schools", die einmal pro Jahreszeit stattfinden sollen, liegen bei den Teilnehmern und werden von Sponsoren gefördert.
Finanzierung des Projekts
Teile des Borgos, wie etwa der Restaurantbetrieb und das Hotel, werden über Konzessionen an Unternehmen vergeben. Zur Höhe der geplanten Investitionen wollte sich der Vatikan nicht äußern. Ein Teil der Einnahmen soll auch hier zurück in das Bildungsangebot fließen. Das nach Medienberichten mehrere Millionen teure Gewächshaus wird von einem Partner betrieben. Die hier produzierten Pflanzen werden in den großen Gärten des Vatikans angepflanzt und weiterverkauft.
Weitere Einnahmen will das Borgo als Konferenz- und Tagungszentrum für Unternehmen generieren, Führungskräften dabei die Prinzipien von "Laudato si" näherbringen. Das Angebot, für einen halben Tag zum Gärtner oder Landwirt zu werden, richtet sich auch an Familien und Kleingruppen. Als "spektakulärer Ort" für Konferenzen und Großveranstaltungen könnten die Räumlichkeiten laut Baggio ebenfalls genutzt werden. Zudem träumen die Organisatoren bereits vom Borgo als Ort der Reflexion für die Staats- und Regierungschefs der Welt.
Nachhaltiges Modell
Dieser soll so nachhaltig und autark wie möglich sein. Man setzt beispielsweise auf wiederverwertbare Materialien, Stromversorgung aus Solarenergie und die eigene Wiederaufbereitung von Wasser. Eine Produktionskapazität, die alle Bedürfnisse des Borgos abdeckt, will die Laudato-si-Leitung jedoch nicht schaffen. Dafür soll ein Liefernetzwerk mit lokalen Landwirten aus der Region entstehen. Dienen soll das Borgo insgesamt als Modell für Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfung und Menschenwürde. Die Initiatoren hoffen auf Nachahmer in aller Welt.