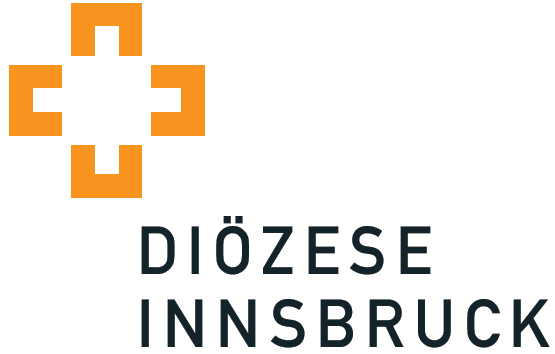Kirchen nicht voreilig zusperren, verwerten oder verkaufen
"Beleben durch Kooperationen, nicht voreiliges Zusperren, Verwerten oder Verkaufen!" Diesem Grundsatz folgt die katholische Kirche in Österreich bei der Neunutzung nicht mehr zu erhaltender Kirchengebäude. Wie der in der Bischofskonferenz für Denkmalschutz zuständige Innsbrucker Bischof in einem Kathpress-Gespräch über dieses Thema ausführte, lege er Wert darauf, "dass wir insgesamt eine neue Lebendigkeit von Kirche im Auge behalten, nicht ein rein von ökonomischen Zielen geleitetes Verwerten der sakralen Räume". Zu Ostern hatte es Glettler in der Wochenzeitung "Die Furche" als "No-Go" bezeichnet, Kirchen rein kommerziell als Geschäfte oder Orte der Unterhaltungsindustrie nachzunutzen.
Das Thema "Profanierung" von Kirchen bekommt durch einige Übergaben an andere christliche Konfessionen und zuletzt durch den Verkauf einer Kirche in Wien-Favoriten an eine Privatperson verstärkt Aufmerksamkeit. Bischof Glettler nennt für diese Übergaben die demografische Entwicklung als wesentlichen Faktor. Gerade in den urbanen Neubauzonen der 1970er- und 1980er-Jahre sei der Anteil der Katholikinnen und Katholiken stark gesunken. Und: Viele Nachkriegskirchen, obwohl architektonisch wertvoll, befänden sich mittlerweile "in einem bautechnisch miserablen Zustand". Glettler nannte mangelnde Betonqualität, Materialermüdungen bei Eisenkonstruktionen und Glas und überalterte Installationen. "Es sind horrende Investitionen notwendig, um speziell die Kirchen der 1970er und 1980er Jahre wieder in einen nachhaltig brauchbaren Zustand zu bekommen." Um die enorm hohe Baulast zu stemmen, braucht es nach den Worten des Bischofs vielfältige Kooperationen.
Als gelungenes Beispiel aus seiner Diözese verwies Glettler auf die sich anbahnende Nutzung der 1972 eingeweihten Petrus-Canisius-Kirche in Innsbruck als Boulderhalle - bei gleichzeitiger Weiterverwendung bestimmter Bereiche des Gebäudes für Gottesdienste und Seelsorge. Die zentrale Altarzone des riesigen Kirchenraums bleibe unberührt von den umgebenden, freistehenden Einbauten für seilfreies Klettern. Die Pfarrverantwortlichen hoffen auf Attraktivität für neues Publikum, und Bischof Glettler sieht - wie er sagte - keine zwingenden Gründe gegen eine Doppelnutzung von Kirchen für kulturelle, soziale oder auch freizeitsportliche Initiativen.
"Kulturell-spirituelles Gemeingut"
Wenn eine Kirche abgegeben werden muss, dann bevorzugt an eine andere Konfession, verwies Glettler auf gelungene Beispiele dafür aus mehreren Diözesen Österreichs. Das sei zugleich Ausdruck ökumenischer Verantwortung, am besten wahrgenommen sogar bei interkonfessioneller Nutzung. Wenn eine religiöse Verwendung eines Kirchengebäudes nicht mehr möglich ist, sei eine Umwidmung als Konzerthalle, Bibliothek oder Unterkunft für Pilger und Obdachlose denkbar. Was im deutschsprachigen Raum zurecht nicht goutiert werde, seien Einkaufszentren, Restaurants, Hotels oder sogar Clubbings in früheren Gotteshäusern. Glettler zitiert dazu aus dem vor knapp einem Jahr veröffentlichten deutschen Kirchenmanifest, das Kirchen als "kulturell-spirituelles Gemeingut" und "radikal öffentliche Orte" beschreibt, deren Zukunft mit allen gesellschaftlichen Akteuren ausgehandelt werden sollte.
Sakrale Räume bieten nach den Worten des Bischofs gerade in der heutigen "nervösen Zeit" die Chance auf innere Sammlung statt Zerstreuung: "Auch wenn jemand nicht selbst an der Liturgie dieser Orte teilnimmt oder diese auch nur mehr spärlich stattfindet, ist der Symbolgehalt von heiligen Räumen nicht zu unterschätzen." Kirchen seien konsumfreie Zonen für Ruhebedürftige, Nachdenkliche, Kurzauszeit- und Trostsuchende unabhängig von ihrem Glaubensbekenntnis, "Zufluchtsorte für alle, die einen Ort mit einer transzendenten Dimension suchen". Kirchen seien auch keine neutralen Räume, so Glettler, "sie tragen ein kulturelles und spirituelles Gedächtnis in sich, wurden über Jahrzehnte, oft auch über Jahrhunderte mit Gebeten, Tränen und Freuden von Menschen aufgeladen". Wie wichtig Kirchen als Orte des Glaubens, der Kultur und der Geschichte sind, "ist erst erfassbar, wenn sie nicht mehr existieren". Dann sei es jedoch zu spät, "und deshalb machen wir uns jetzt so viele Gedanken zum Umgang mit Kirchen, wo wir noch nicht unmittelbar zum Handeln gezwungen sind, aber die kommenden Veränderungen wahrnehmen".
"Bitte die Kirche im Dorf lassen!"
Jedoch: Es sollte bei diesem Thema "keine Panik verbreitet werden", warnte Glettler: "Bitte die Kirche im Dorf lassen!" Anders als etwa in Deutschland stehe hierzulande nur eine geringe Anzahl von sakralen Objekten zur Disposition. Das sei auch den Kirchenbeitragszahlenden und vielen Freiwilligen vor Ort zu verdanken, die dem Staat, den Menschen in Österreich und den Touristen "die schönsten Kulturgüter" erhalten. "Wir können den unzähligen Gläubigen in Österreich unendlich dankbar sein, dass mit ihrem finanziellen und tatkräftigen Engagement Kirchen, Kapellen und andere kirchliche Gebäude in einem respektablen Zustand erhalten, ja großteils immer wieder hervorragend restauriert werden".
Insgesamt seien mehr als 40 Prozent der denkmalgeschützten Objekte in Österreich in kirchlichem Besitz und müssten von den Diözesen, Ordensgemeinschaften und Pfarren erhalten werden, wies der Bischof hin. "Das ist eine ungewöhnlich hohe kulturelle Leistung, die kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird." Kritisch merkte Glettler an, dass die Unterstützung durch das Bundesdenkmalamt bei weitem nicht die Höhe der Mehrwertsteuer decke, die bei den Baukosten anfällt. "Das heißt, der Staat Österreich verdient mit der Erhaltung der denkmalgeschützten Gebäude!"
Kirchenrechtlich zuständig für Profanierungen von Kirchen sind die Diözesanbischöfe, es gibt laut Glettler aber Überlegungen in der Bischofskonferenz zu österreichweit geltenden Kriterien für Nachnutzungen. Wichtig sei, dass jeweils "ein sorgsamer, gut strukturierter Prozess eingeleitet wird, in dem alle Beteiligten gut gehört werden - und auch die kommunalen Interessen eingebracht werden können".
Im Juni soll auch eine Broschüre erscheinen, die aus allen Diözesen Best-Practice-Beispiele für Sanierungen und Neu- bzw. Umnutzungen von Pfarrhöfen versammelt. Glettler sprach sich dabei für eine pastorale oder eine kommunale Mischnutzung zwischen Pfarren, Gemeinden, Vereinen o.ä. aus. Leerstehende Pfarrhäuser, Widen oder Pfarrhöfe seien ein wesentlich größeres Thema als die Kirchenumnutzungen, erklärte Glettler. Für ihn ist es "ein verheerendes Bild, wenn in der Mitte des Dorfes ein Pfarrhaus über viele Jahre leer steht". Leerstände dieser Art würden ein depressives Grundgefühl verbreiten, das dem Zeugnis von Kirche widerspricht.
Eine Meldung von www.kathpress.at