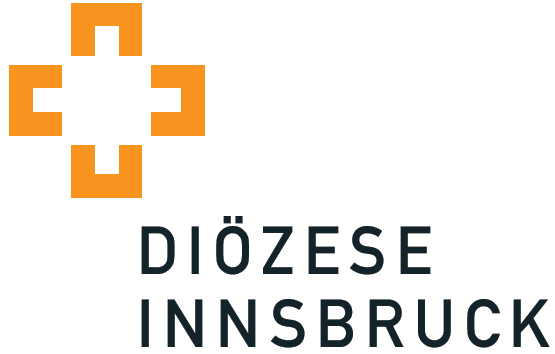Ansturm auf päpstliche Segensurkunden seit Amtsbeginn
Der Amtsantritt von Papst Leo XIV. hat zu einem spürbaren Anstieg der Nachfrage nach apostolischen Segensurkunden geführt. Wie der Päpstliche Almosenmeister, Kardinal Konrad Krajewski, gegenüber der Nachrichtenplattform CNA bestätigte, verzeichnete das zuständige vatikanische Amt im Juni rund 20.000 Anträge auf Segensurkunden. In einem durchschnittlichen Monat werden sonst zwischen 12.000 und 15.000 solcher Urkunden ausgestellt.
Nach Angaben Krajewskis ist der Anstieg "beispiellos" und deutlich über dem sonst in der jüngeren Geschichte des Vatikans bekannten Ausmaß. Zurückzuführen sei er auf die weltweite Aufmerksamkeit für den neuen Pontifex sowie auf die zeitliche Nähe zu Sakramentenspendungen wie Erstkommunion, Firmung oder Priesterweihe, die oft als Anlässe für die Urkunden-Ausstellung genutzt werden.
Nach Ende der Sedisvakanz im Mai und der Wahl von Leo XIV. sei es zu erheblichen Wartezeiten bei der Urkunden-Ausstellung gekommen. Die Warteschlange vor dem zuständigen Vatikan-Büro habe sich über mehrere hundert Meter erstreckt. Zeitweise mussten Online-Bestellungen aus Kapazitätsgründen ausgesetzt werden.
Die Ausstellung einer päpstlichen Segensurkunde ist mit einer empfohlenen Spende von rund 20 bis 35 Euro verbunden. Diese Beträge sind laut Vatikan freiwillig, finanzieren jedoch ausschließlich karitative Projekte des Päpstlichen Almosenamts. Kardial Krajewski betonte, dass diese Einnahmen im Jahr 2024 den Großteil der rund 7,4 Millionen Euro ausgemacht hätten, die für weltweite Hilfsprojekte eingesetzt wurden.
Zu den mithilfe dieser Mittel unterstützten Maßnahmen zählen unter anderem Soforthilfen bei Naturkatastrophen, medizinische Versorgung in Krisengebieten und die Versorgung von Bedürftigen in Kriegsregionen. So habe man kürzlich unter anderem Betroffene eines Taifuns in Taiwan unterstützt sowie einen mobilen Backofen für die ukrainische Stadt Charkiw finanziert.
Elf Kalligrafen beschäftigt
Die Ausstellung der Urkunden erfolgt seit dem späten 19. Jahrhundert und ist ausschließlich zu bestimmten Anlässen möglich, darunter Taufen, Eheschließungen, Ordensjubiläen und runde Geburtstage. Der Antrag kann entweder vor Ort im Vatikan oder über die offizielle Website gestellt werden. Seit 2014 ist der Verkauf über externe Buchhandlungen oder Souvenirläden nicht mehr gestattet.
Für die Anfertigung der Urkunden beschäftigt das Almosenamt derzeit elf Kalligrafen. Der Großteil der Dokumente wird heute maschinell erstellt, enthält aber weiterhin handschriftliche und kunstvolle Elemente. Die Produktion einer einzelnen Urkunde dauert in der Regel zwei bis drei Wochen, inklusive Prüfung und Versand.
Die Segensurkunde dient nicht nur als religiöses Dokument, sondern wird vielfach im häuslichen Umfeld sichtbar platziert und als Zeichen der Nähe zum Papst empfunden. Es handle sich, so Kardinal Krajewski, um eine "menschlich verständliche Geste des Trostes und der geistlichen Unterstützung" wie auch als "Ausdruck der Verbundenheit vieler Gläubiger mit dem Nachfolger Petri".
Meldungen von www.kathpress.at

100 Tage Papst Leo XIV.: Von stürmischer See in ruhige Gewässer
Es ist ruhig geworden um den Vatikan. Nach anfänglicher Euphorie um den ersten US-amerikanischen Papst haben sich die Berichte über Leo XIV. in der internationalen Presse reduziert. Der gebürtige Chicagoer liefert für das eher kirchenferne Publikum schlicht keine Schlagzeilen. Bedacht liest er seine vorbereiteten Ansprachen ab, die seltenen Abweichungen sind nicht erwähnenswert. Er geht freundlich auf Menschen zu, seine Nahbarkeit wirkt authentisch, doch zugleich immer ein wenig distanziert.
Ganz sicher angekommen scheint Leo nach 100 Tagen (16. August) noch nicht in seinem Amt als Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken. Mitunter etwas erstaunt betrachtet er die Menschenmengen, die seinetwegen aus aller Welt nach Rom anreisen.
Große Fußstapfen und tiefe Fettnäpfchen
Sein Vorgänger Franziskus hätte für jeden Nachfolger große Fußstapfen hinterlassen. Die Nähe zu Menschen war Lebenselixier des Argentiniers, ohne Berührungsängste ging er auf jeden und jede zu und begeisterte damit auch Nicht-Gläubige. Er verabscheute päpstliche Statussymbole und vermied weder Konflikte noch Fettnäpfchen, die immer wieder zu diplomatischen Erschütterungen führten.
Seine Sprache war direkt, die Inhalte meist spontan und mitunter zweideutig. Die vom vatikanischen Staatssekretariat sorgfältig vorbereiteten Ansprachen dienten Franziskus höchstens als Vorschlag, von dem er ein ums andere Mal abwich - oder am liebsten gleich den Journalisten seine Meinung ins Mikrofon sagte. Oft sorgte er damit für Schlagzeilen und eine erhebliche Reichweite in den Medien.
Sicherheit durch das Vatikan-Protokoll
Genau diese Schlagzeilen scheint Leo XIV. vermeiden zu wollen. Die Spannungen, die Franziskus mit seiner Art und seinen Reformen in Vatikan und Weltkirche auslöste, ebenso. Denn deren direkte Auswirkungen erlebte er in den vergangenen zwei Jahren als Leiter der Bischofsbehörde hautnah mit. Bis er seinen eigenen Umgang mit dem Amt gefunden hat, nutzt der neue Papst das strenge vatikanische Protokoll als Sicherungsleine, überlässt erfahrenen Redenschreibern den Umgang mit theologischen wie politischen Themen.
Äußerlich orientiert sich Leo XIV. seit seiner Wahl am 8. Mai an den Päpsten vor Franziskus - bis auf die schwarzen Schuhe. Der 69-Jährige lässt den Ringkuss wieder zu und trägt die Mozetta, den roten Schulterkragen aus Seide. Er wird in die für Päpste vorgesehene Wohnung im Apostolischen Palast ziehen und begibt sich im römischen Hochsommer nach Castel Gandolfo. Franziskus bevorzugte den Daueraufenthalt im vatikanischen Gästehaus Santa Marta - ohne Urlaub.
Ein Papst für alle, alle, alle?
Bei der äußerlichen Inszenierung mag der Amerikaner konservativ sein. Inhaltlich, insbesondere was die Teilhabe aller Gläubigen an Entscheidungsprozessen in der katholischen Kirche angeht, ist Leo XIV. ganz auf Linie seines Vorgängers. So können derzeit alle katholischen Lager "ein Stückchen Papst" für sich beanspruchen und wirken zufrieden. Ikonische Momente, die ganze Pontifikate prägten, wie Franziskus' offene Kirche für "alle, alle, alle" fehlen noch in Leos Portfolio.
Doch ist auch der neue Papst den Menschen zugewandt und für Scherze zu haben. Aber auf Tuchfühlung geht er ungern, verzichtet aus diesem Grund wohl weitestgehend auf Selfies. Deutlich gelöster als in einer Umarmung wirkt er bei den zahlreichen Fahrten im Papamobil, bei denen er viele Menschen gleichzeitig begrüßen kann und für jeweils nur einen kurzen Moment in deren Rampenlicht steht.
Auf der großen Bühne hingegen wirkt der US-Amerikaner eher schüchtern, hält die Hände vor dem Bauch verschränkt, wippt und zieht immer wieder die Schultern hoch. Seine Stimme steht sinnbildlich für die (noch) angezogene Handbremse seines Pontifikats. Ihr Erheben gleicht mehr einem Drücken, als würde Leo sich selbst noch zurückhalten, aber die emotionalen Erwartungen erfüllen wollen.
"Flitterwochen" mit dem Papst
Der Papst und die Menschen befinden sich nach 100 Tagen noch in der Kennenlernphase. Mögliche Schwerpunkte des Pontifikats lassen sich nur vermuten. Zudem gab Leo XIV. bislang keine Interviews, die Rückschlüsse auf sein Denken zuließen. An seinem ersten Grundsatzschreiben, einer Enzyklika, soll das neue Kirchenoberhaupt bereits arbeiten, doch das mögliche Themenspektrum ist weit. Ebenso stehen noch wichtige Personalentscheidungen in der Kurie aus, die Hinweise auf Leos künftigen Weg geben können. Leo ist der erste Papst aus den USA, der erste Augustinermönch und war vor seiner Wahl erst zwei Jahre lang ein Kardinal und in einem Kurienamt.
Derzeit führt er viele Gespräche mit seinen - vorerst bestätigten - Behördenleitern und scheint seine Entscheidungen in aller Ruhe und vor allem mit Bedacht treffen zu wollen. Die durch Franziskus mitunter erschütterte Kirche soll und will er wieder zu mehr Einigkeit führen. Zugleich müssen die von seinem Vorgänger angestoßenen Reformen entschlossen umgesetzt werden. Bei alldem darf das neue Kirchenoberhaupt die Welt außerhalb der "katholischen Blase" nicht aus dem Blick und die Stimme der Kirche nicht an zu viel Reichweite verlieren. Ob das gelingt, wird sich nach den "Flitterwochen" zeigen.
Meldungen von www.kathpress.at