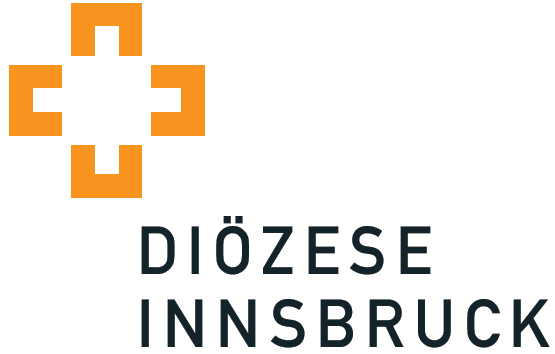Theologischer Blick: Hoffnung auf eine dienende Kirche
Zahlreiche Hoffnungen und Erwartungen knüpfen sich an die Wahl jedes neuen Papstes. Deren Umfang wird durch den Blick auf die Vorgänger im Amt nicht gerade geringer, soll der Neue doch möglichst alles mitbringen, was jeder seiner Vorgänger je für sich als Qualität aufzuweisen hatte. So spannt sich der Anforderungsbogen in diesen Tagen vom persönlichen und medialen Charisma und liebeswürdiger Leutseligkeit über tiefe theologische Kompetenz hin zum diplomatischen Geschick und der weltpolitischen Wirksamkeit, von der Versöhnungskompetenz hin zum durchsetzungsstarken Erneuerungsgeist. Wir sollten uns davor hüten, ein Pontifikat bereits in den ersten Stunden dadurch zum Scheitern zu verurteilen, dass die Ansprüche daran in unermessliche Höhen getrieben werden, die weder vom Papst als Person, noch von der Kirche als Gemeinschaft erreicht werden können.
Was erhofft sich nun ein katholischer Theologe, insbesondere ein Sozialethiker, der auch Verantwortung für eine Fakultät trägt, von Papst Leo XIV., nachdem er sich selbst zur Mäßigung ermahnt hat.
Tatsächlich wird dieser Papst wohl in besonderer Weise als Pontifex gefordert sein, als Brückenbauer. Ich denke das gilt auch im Hinblick auf die Lehre der Kirche, insbesondere, was ihr theologisches Selbstverständnis betrifft. Papst Franziskus hatte von der armen Kirche für die Armen gesprochen und von einer Kirche, die besser verbeult durch ihr Engagement für die Menschen ist, als gut erhalten, aber nutzlos. Dies ist meines Erachtens ganz im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils, das in seiner Pastoralkonstitution schrieb, dass die Kirche frei von irdischem Machtstreben das Werk Christi weiterführen will „um zu heilen, nicht um zu richten, um zu dienen, nicht um sich bedienen zu lassen“ (GS 3). Franziskus hat uns in besonderer Deutlichkeit vor Augen geführt, dass dieses Ideal noch immer oder vielleicht auch immer wieder verfehlt wird. Ihm näher zu kommen erfordert die permanente Arbeit an eigenen Haltungen, es erfordert das beständige Ringen um die Frage, was Heilen und Dienen in der je konkreten Situation bedeuten, es erfordert aber auch theologische Antworten, die sich in der Ausbuchstabierung der Lehre der Kirche für die heutige Zeit niederschlagen. Dabei sind Spannungen zwischen dem Wunsch treu zu bewahren, und jenem, flexibel auf die Zeichen der Zeit zu reagieren, vorprogrammiert. Ein Papst kann in diesem Spannungsfeld nicht die richtigen Antworten geben, er könnte aber doch die Rolle des Moderators spielen, der unterschiedliche Stimmen zu einer Harmonie zusammenführt, selbst wenn diese oft nicht ganz rein sein mag. Der Wahlspruch des neuen Papstes, der zum Ausdruck bringt, dass wir in Christus alle eins sind, scheint mir darauf hinzudeuten, dass er dieses Ziel verfolgt. Zugleich impliziert dieser Wahlspruch aber eben auch, dass wir viele, ganz unterschiedliche Menschen und Gemeinschaften sind. Papst Franziskus hatte gefordert, dass wir ein harmonisches Zusammenleben lernen sollten, ohne zu meinen wir, müssten alle gleich sein (FT 100). Gelingt es uns als Weltkirche, dem Schritt für Schritt näher zu kommen, dann haben wir viel aus dem synodalen Prozess gelernt. Ich bin zuversichtlich, dass Papst Leo uns in diese Richtung voranbringen will.
Eine echte Einheit in Buntheit und Vielgestaltigkeit wird es aber wohl nur geben, wenn wir in unserer Kirche mehr Subsidiarität zulassen, wenn es unterschiedliche Geschwindigkeiten des Gehens geben darf und ein mutiges Sich-Einlassen auf unterschiedliche Herausforderungen. Robert Prevost, der aus seiner Biografie sehr unterschiedliche weltkirchliche Erfahrungen mitbringt, scheint mir – anhand des Wenigen, das ich über ihn in Erfahrung bringen konnte – ein vorsichtiger und bedachter Mensch zu sein. Das ist gut so. Vielleicht erlaubt es gerade das, an den entscheidenden Stellen auch mutig zu sein und im Vertrauen auf den Geist, der in der Kirche Wirkt, Wagnisse einzugehen.
Damit möchte ich eine Formulierung von Paul Michael Zulehner aufgreifen, der meinte, dass Papst Leo XIV. den Duft des Franziskus in einen Flacon einfangen sollte. Flüchtige Impulse sollten also nicht eingefroren, aber eben doch in eine handhabbare Form gebracht werden. Die immer wieder nötige Erneuerung der Kirche ist grundlegend eine geistliche und spirituelle Aufgabe. Die Grundlage ist aber noch nicht das Ganze. Die Kirche als Leib Christi ist eine körperliche Realität, eine soziale Wirklichkeit, die Strukturen und Regeln braucht und ja auch hat. Liebe und Barmherzigkeit bedürfen - darauf hat Benedikt XVI. hingewiesen (CiV 3) - auch der Gerechtigkeit, um nicht in luftiger Gefühligkeit hängen zu bleiben. Das gilt, auch wenn die Gerechtigkeit allein ungenügend und ein hartes Pflaster wäre. Konkret bedeutet das, dass der neue Papst versuchen sollte, einige der starken pastoralen Zeichen seines Vorgängers in der rechtlich-sozialen Struktur der Kirche zu verleiblichen. „Die organisatorischen und strukturellen Reformen sind sekundär, sie kommen danach. Die erste Reform muss die der Einstellung sein.“ So hatte es Franziskus in seinem berühmten Interview mit dem Jesuiten Antonio Spadaro formuliert. Er hatte aber nicht gesagt, dass sie völlig unnötig seien.
Theolog:innen können und sollen nicht die Aufgabe der Kirchenleitung übernehmen. Sie haben aber die mitunter unbequeme prophetische Aufgabe wahrzunehmen, die auch darin besteht, auf Punkte hinzuweisen, an denen Wagnisse eingegangen werden können und an denen strukturelle Veränderungen möglich bzw. notwendig erscheinen. Noch viel mehr als die Gesamtkirche sind die Stimmen der Theologie vielfältig, mitunter widersprüchlich. Von Leo XIV. wird gesagt er sei ein Mann der gut zuhören könne. Dass er auch auf die Buntheit der theologischen Stimmen hört, und sich davon da und dort anregen lässt, darf ein Theologe sich zumindest wünschen.
Eine Kirche, die dient und heilt ist kein Selbstzweck. Das gilt auch für die Theologie. Beide haben sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen, um ihren Beitrag zur Schaffung von Lebensräumen zu leisten, in denen Menschen fähig werden und bleiben, die Liebe Gottes anzunehmen. Solche Lebensräume sind meinem Verständnis nach das Ziel des Einsatzes für Friede, Gerechtigkeit und eine intakte Schöpfung. Darin wird Gottesdienst sehr konkret und erdverbunden. Als Theologe und Christ hänge ich an einem solch konkreten Glauben und einer solche erdverbundenen Kirche. Johannes Paul II. hat im Gewissen dieser Kirche die Option für die Armen und Schwachen tief eingeschrieben. Diese Option bündelt geradezu den Geist der biblischen Offenbarung von der Befreiung Israels aus der Knechtschaft in Ägypten bis hin zur Bitte Jesu am Kreuz: „Vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“. In einer Welt, in der das Recht des Stärkeren wieder zur allgemein akzeptierten Norm zu werden scheint, ist die Option für die Schwachen das Licht der Menschlichkeit, das es auf den Leuchter zu stellen gilt. Ich denke, dass wir mit unserem neuen Papst gemeinsam dieses Licht hochhalten sollten – betend, argumentierend und handelnd. Unsere Glaubenstradition sagt mir, dass das möglich ist, weil wir es in der Kraft des menschenfreundlichen Gottes tun.