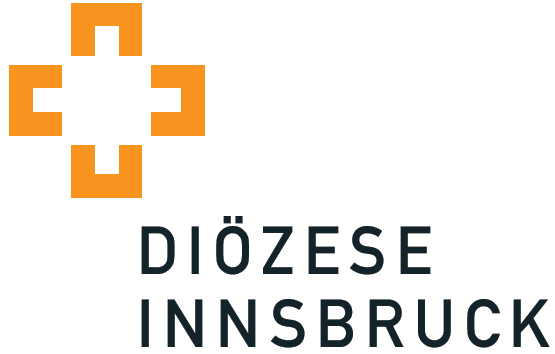Kunstinterventionen zur Fastenzeit in Innsbrucker Kirchen
Bis ins Mittelalter lässt sich der Brauch zurückverfolgen, in der Fastenzeit den Altar mit Tüchern oder Leinwand zu verhüllen. Die bildlichen Darstellungen wurden damit während der Fastenzeit den Blicken der Gläubigen und des Klerus entzogen und dagegen die Entbehrung der Fastenzeit künstlerisch umgesetzt. Die ältesten Fastentücher, oft auch Hungertücher genannt, waren zunächst schlichte und schmucklose Stoffbahnen. Unter anderem in den Alpenregionen erlebte der Brauch der Fastentücher eine große Blüte und wurden ihrerseits inhaltlich stark aufgeladen und kunstvoll ausgeführt.
In jüngerer Zeit werden die Fastentücher als Bedeutungsträger vermehrt wiederentdeckt und erleben als Bildfläche für künstlerische Interventionen gerade auch in der Diözese Innsbruck eine Renaissance. In der Fastenzeit sind die Besucher:innen eingeladen, den Blick weg von vertrauten Darstellungen hin auf marginalisierte Themen zu richten.
Dom zu St. Jakob
Jakob Kirchmayr, „Spuren des Feuers“, mehrteiliges, großformatiges Fastentuch, 2023/24, mit Feuer bearbeitete Stoffe. (Leihgabe des Künstlers)
Das überwältigende „Fastentuch“ des in Wien lebenden Künstlers Jakob Kirchmayr besteht aus 20 verbrannten, geräucherten, mit Asche, Erde und Kohle abgeriebenen und dem Regen ausgesetzten Baumwolltüchern. Die Spuren des Feuers sind offensichtlich – wirken bedrohlich apokalyptisch und wunderschön zugleich. 140 Quadratmeter Stoff händisch vernäht – aufgrund der Bearbeitung ein einziger großer „Trauerfetzen“. Auf der Rückseite hält eine Konstruktion aus Seilen das fragile Gewebe zusammen. Durch das Raffen und Knittern der Tücher entstand ein Bildwerk mit skulpturalem Charakter. Es beansprucht den Raum und nimmt sich zugleich zurück – wie ein fragiler, verletzter Leib schwebt es vor uns. Und berührt mit seinen offensichtlichen Spuren von Verletzungen.
Sind es die großen apokalyptischen Bedrohungen unserer Zeit, die wir hier indirekt vor Augen haben? Die Vernichtungspotentiale, die alles in Brand setzen können? Oder sehen wir, was von den Bettlaken in den von Krieg verödeten Häusern und Spitälern übrigblieb? Wir wissen es nicht. Gefühlt sind es Tücher der Sehnsucht, sich endlich wieder bergen zu dürfen, wo und bei wem auch immer. "Unsere Welt scheint an einem Wendepunkt angelangt zu sein und wir müssen achtsam sein, dass unsere Gesellschaft nicht daran zerfällt“, sagt Jakob Kirchmayr und fügt deutend zum Tuch hinzu: „Vielleicht ein Zeichen der Hoffnung, denn die vielen Relikte, die vom zerstörerischen Feuer übrigblieben, wurden zu einer Einheit zusammengenäht – die Nähte erinnern wie Narben an Wunden.“ Ein Neubeginn nach dem Feuer?

Spitalskirche
Volker Hildebrandt, „Große Bildstörung“, Acryl auf Leinwand, 1992. (Leihgabe des Künstlers)
Einer extrem beschleunigten Bildproduktion, die zunehmend von Künstlicher Intelligenz gesteuert wird, stellt sich die „Große Bildstörung“ beherzt entgegen. Das Gemälde schafft eine Ruhezone. Es erinnert uns an die Mattscheibe der alten Fernsehgeräte, wo es noch keine perfekt aufgelösten HD-Bilder gab. Im hochtechnisierten Kommunikationszeitalter wirkt es jedoch wie ein Schritt zurück. Damals waren die TV-Bilder noch neu – und nach Sendeschluss zu Mitternacht gab es das grau flimmernde Standbild. Volker Hildebrand bringt das Flimmern der typischen schwarzen, weißen und grauen Bildstörungs-Punkte (Schnee) mit Acrylfarbe auf die Leinwand. Eigenartig beruhigend! Eine Entlastung von der Überdosis visueller Signale und Reize.
Das Fastentuch in der Spitalskirche ist damit ein Bild und Nicht-Bild zugleich. Es stellt zumindest den Bilder-Tsunami unserer Zeit in Frage. Möglicherweise inspiriert vom Bilderverbot der jüdischen Tradition: „ Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben oder auf der Erde unten“ (Ex 20,4). Auch wenn wir als Christen aufgrund von Gottes Menschwerdung zurecht das Bild Jesu Christi und der Heiligen verehren, bleibt die alttestamentliche Mahnung aufrecht: Kein Bild! Warum? Um die Seele zu reinigen, zu entlasten – und vorzubereiten auf eine Begegnung mit dem unfassbaren Gott des Lebens! Die „Große Störung“ kann uns im Programmlauf einer nervös agitierenden Gesellschaft dabei helfen.

Pfarrkirche St. Nikolaus
Thomas Feuerstein, „PLANETARES BLAU“, 15 x 7m, mit 40² ultramarin blau gefärbtem Stoff überzogenes Segelflugzeug aus den 60er Jahren, 2026. (Leihgabe des Künstlers)
Das ultramarinblaue Segelflugzeit zieht den Blick nach oben. Eingespannt in die Vierung greift das Flugobjekt mit einer Spannweite von 15 Meter die Aufwärtsbewegung der neugotischen Architektur auf. „Als Übergangsobjekt zwischen dem Blau des Meeres und des Himmels wird es zum Bluescreen für Sehnsüchte und Mängel unserer Zeit, für ökologische Krisen, Ressourcenknappheit und die Fragilität des Raumschiffs Erde“, so der Künstler Thomas Feuerstein. Damit ist die wesentliche Spannung dieser Kunstintervention benannt. Der nach oben weisende Flieger ist Bild für die nicht domestizierbare Sehnsucht, die wir in uns tragen. Eine Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit und was auch immer – letztlich vielleicht nach Gott.
Die dynamische Aufwärtsbewegung ist gegenläufig zu allem, was weltweit an Gewalt und Zerstörung gerade „niedergeht“ – und unser Leben belastet. Das kostbare Ultramarin Blau, von Feuerstein aus Kieselalgen produziert (geschütztes Patent!), unterstützt die Dynamik nach oben, lenkt aber zugleich die Aufmerksamkeit auf die Erde. Kieselalgen binden in den Ozeanen 20% des Kohlenstoffdioxids und generieren 50% des Sauerstoffs. Ohne sie gäbe es keinen blauen Planeten Erde. Das besondere Blau, das von Giotto bis Yves Klein als Farbe des Himmels und der Transzendenz verwendet wurde, kommt also nicht mehr „über das Meer“ (ultramarin), sondern aus dem Meer – und verweist auf die Bedeutung globaler Stoffwechselkreisläufe und deren Fragilität. Sie zu schützen und Verantwortung zu übernehmen liegt an uns.

Jesuitenkirche
Ronald Kodritsch, „BLABABELS“, 6x3m, Gemälde im Hochformat, 2026. (Leihgabe des Künstlers)
Das großformatige Gemälde von Ronald Kodritsch wirkt wie ein ornamentaler Farbteppich – bei näherem Hinsehen erkennt man erst die bunten, aufgeblähten Sprechblasen. Aber ohne Text, ohne Inhalt. Sie bilden ein Gewirr von Leerstellen, offensichtlich viel BlaBla, viel heiße Luft. Wie aktuell für unsere Zeit! Knallige Behauptungen ohne Hinhören, inflationäres Geschwätz, wo das Schweigen heilsam wäre. Die (leeren) Sprechblasen kommen im Werk von Kodritsch häufig vor. Mit skurrilen Bildserien, auf denen uralte Traktoren, putzige Pudel, Flaschen-Geister und eben auch Sprechblasen zu sehen sind, hat er sich als „Bad Painter“ einen Namen gemacht. Ein Ablenkungsmanöver, weil es ja um Malerei und nicht um die Erörterung von Themen gehen soll?
Der Wirrwarr aus knalligen Sprechblasen wird jedenfalls zum kritischen Spiegel. Nicht erst seit der KI-generierten Bild- und Textflut ist die Qualität unserer Kommunikation auf dem Prüfstand. Was sagen wir denn wirklich? Welche Botschaft transportieren wir? Die Sprechblasen erinnern im kirchlichen Kontext an die biblischen Spruchbänder auf Gemälden und Fresken der Spätgotik. Sie mussten die Bilder katechetisch verstehbar machen. Wesentlich näher ist Kodritsch die populäre Comic-Kultur. Gerade weil sie zu Unrecht als belanglos galt, interessiert er sich dafür. Sein Bild „BLABABELS“ bringt sowohl den leeren Smalltalk (BlaBlaBla) als auch die babylonische Sprachverwirrung zum Ausdruck. Hilft die Fastenzeit diese zu überwinden? Kodritsch führt sie uns zumindest in einem faszinierenden malerischen Akt vor Augen.

Universitätskirche St. Johannes
Aljoscha, „Morphogenesis Bioism“, 2026, Installation schwebender Skulpturen, Fotos aus der Ukraine. (mit freundlicher Unterstützung der Galerie Maximilian Vogt, Lustenau)
Der 1974 in Losowa, Ukrainische SSR, als Olexiy Potupin geborene Bildhauer, der für seine raumgreifenden Installationen bekannt ist, bringt in der barocken Kirche St. Johannes fremdartige Formen des Lebendigen zum Schweben. Es ist ein Gefüge gleitender Elemente – farblich im Wechsel zwischen einem fluoreszierenden Gelb und strengen Schwarzton. Bereitet Aljoscha damit eine Ästhetik der Zukunft vor, die erstarrten Strukturen zu trotzen vermag? Was wir sehen, ist jedenfalls der Natur verpflichtet und zugleich gänzlich von ihr gelöst. Jedes Element wird vom Künstler als hypothetisches, nicht-leidendes Lebewesen verstanden – als Ausdruck synthetischer Vitalität und Vielfalt. Aljoscha hält mit seinen futuristischen Kreationen den vielen Auslöschungen von Leben das Paradigma einer Neuschöpfung entgegen.
Die wahrnehmbare Lebendigkeit hat nichts mit einer ästhetischen Beliebigkeit zu tun. Es geht letztlich auch um eine Wahrnehmung dessen, was in der Luft liegt. Die tödlichen Angriffe auf die Ukraine erreichen im vierten Kriegswinter eine neue Intensität. Unerträgliche Aggression und in deren Folge bitteres Leid für alle Betroffenen – Kälte, Angst und Verzweiflung. Einige Fotos, die auf den Seitenaltären zu sehen sind, zeugen davon. Es sind keine Artefakte, sondern Belege für ein menschliches Mitfühlen und Mitleiden. Und noch ein Bezug: An der Decke befindet sich ein spätbarockes Fresko von Joseph Schöpf. Es zeigt den Leichnam des Hl. Johannes Nepomuk, der von der Moldau angeschwemmt wurde. Darüber drei phantastische Engel im Tanz – zärtlich, stark, real! Die Objekte von Aljoscha scheinen mit ihnen verwandt zu sein.

Pfarrkirche Mariahilf
Elke Silvia Krystufek, „She-Jesus“, 2025/26, mehrteilige Bildinstallation auf dem barocken Altarbild. (Leihgaben der Künstlerin, der Galerie Croy Nielsen und der Galerie Bernd Kuglier)
Die Wiener Künstlerin reagiert mit facettenreichen Bildvariationen auf zwei Marienbildnisse von Lucas Cranach d. Ä. in Innsbruck. Das eine ist das weltberühmte Gnadenbild im Dom St. Jakob, das zweite, kaum bekannt, eine „Maria lactans“ in der Kapuzinerkirche. Die barocke Kopie des Cranach-Bildes in der Wallfahrtskirche Mariahilf, die 1649 als Dank für die Bewahrung vor Kriegswirren erbaut wurde, stammt von Michael Waldmann d. Ä. – und das Rahmenbild mit der Historie der Stiftung von Hans Schor. Reiht sich nun Krystufek in die Liste der abertausenden Kopisten des genialen Mariahilf-Bildes ein? Ja und Nein. Das freche Bananen-Smiley-Porträt verbietet ein zu rasches Verstehen ihrer Intention – und ein Schubladisieren des Gezeigten.
Was sehen wir? Verborgenes, um den inneren Blick zu reinigen und herauszufordern. Die in Wien lebende Künstlerin versucht eine zaghafte, fast spielerische Annäherung an das ehrwürdige Andachtsbild mit der Installation „She-Jesus“. Skizzenhaft und mit zarten malerischen Spuren tastet sie sich an den Originalen entlang – berührend das Werk, das in Kooperation mit ihrer Tochter LIL entstand, die vor 10 Jahren mit Down Syndrom zur Welt kam. Stark im Ensemble ist die Version mit einer Vollverschleierung der Mutter Jesu – oder steckt hinter dem Niqab das berühmte Selbstporträt von Albrecht Dürer als Christus? He or She? Ein Beitrag zum aktuellen Diskurs rund um geschlechtliche Identitäten – oder ein Protest gegen religiöse Gewalt? Ja und.

Pfarrkirche Guter Hirte
Graham Sutherland, Studie zu „Christ in Glory“, quoted bei SUSI POP, Siebdruck auf Leinwand, 2025. (Leihgabe der bischöflichen Mensa an die Pfarre)
„Christ in Glory“ ist ein Siebdruck des Berliner Künstlerkollektivs SUSI POP nach einem Entwurf des britischen Künstlers Graham Sutherland. Der Entwurf wurde etwas verändert als großformatige Tapisserie für die Cathedral St. Michael in Coventry ausgeführt, die man neben den Ruinen des 1940 zerstörten Vorgängerbaus errichtet hat. Dieses Werk war erstmals bei der Ausstellung „blicke nach innen. NICÄA“ – zur Erinnerung an das Erste Ökumenische Konzil im Jahre 325 in Nicäa – auf Schloss Bruck bei Lienz im Jahr 2025 zu sehen. Die durchgängige Farbe Magenta taucht die Grafik in einen farblichen Flow, der die heilige Bewegung des Bildes rahmt und verstärkt. Es ist ein Fluss göttlicher Energie – von oben herab zur Pieta mit dem Leib Christi.
Die Grafik von Graham Sutherland zeigt den endzeitlichen Christus in einer mehrschaligen Mandorla. Getragen wird das herrschaftlich und doch berührend zärtliche Christusbild von den vier Symboltieren, die für die vier Evangelien stehen. Sie berühren und verehren die heilige Schale des Herrschenden. Soweit ist das Bild vertraut – und doch anders: Die Arme des Christus weisen nach unten, die Hände geöffnet, als ob sie eine Quelle symbolisieren wollen. Es ist nicht zu übersehen, dass die zentrale Figur mit dieser Geste und mit dem stark betonten Becken auch feminine, mütterliche Züge trägt. Fazit: Aus dem Schoss des Ewigen empfangen wir Leben und Barmherzigkeit. Und diese göttliche Energie mündet im Kelch zu Füßen des Thronenden.